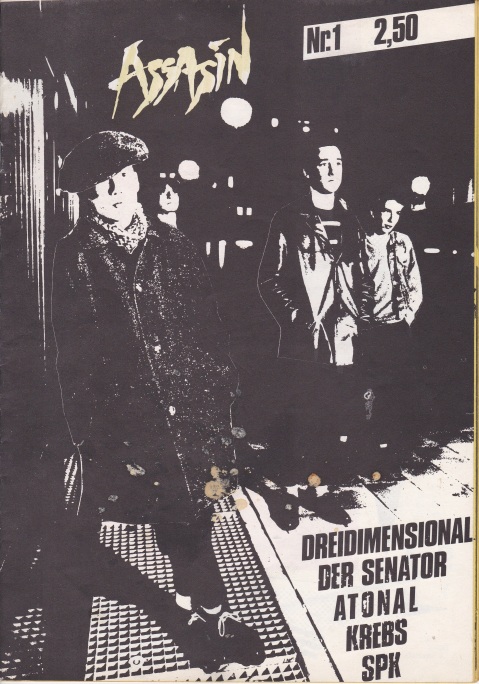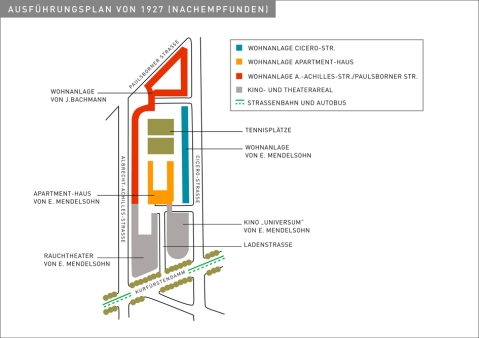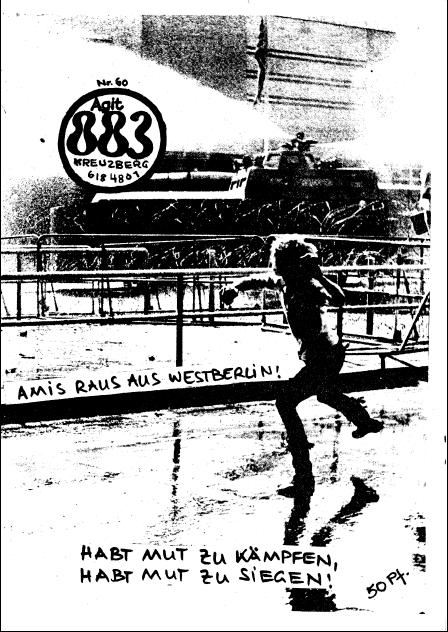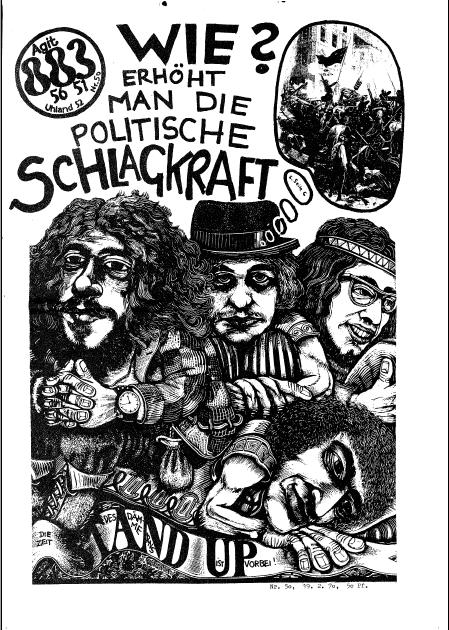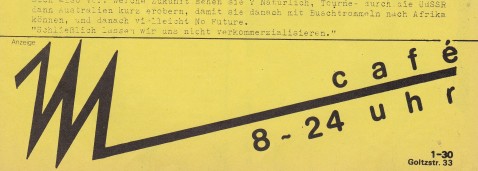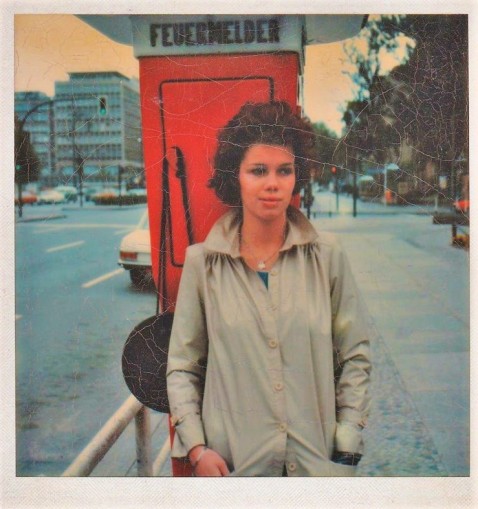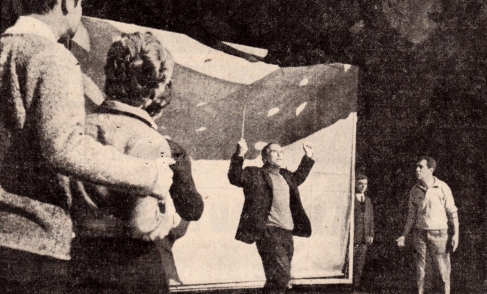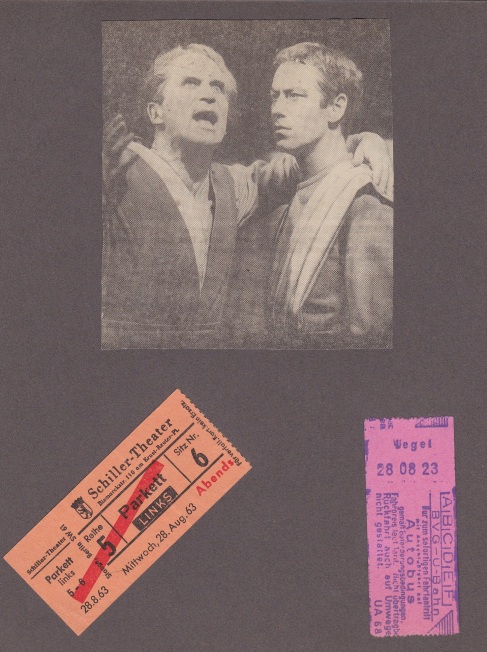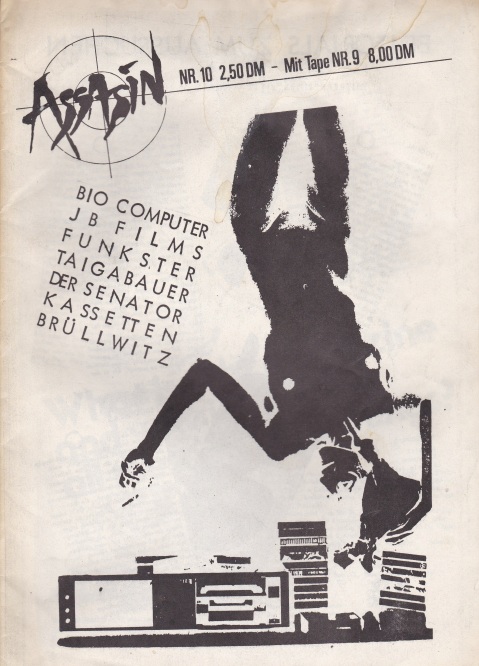Familienportrait Spezial: Weihnachten – „Bauchpinseln am Boxing Day” / 1922-1968

Allen Freunden, Lesern und Bilderguckern ein frohes Weihnachtsfest und Guten Rutsch in ein hoffentlich gutes Jahr 2018.
Foto oben: Vater und Mutter Anfang der 1950er Jahre
Käte, meine Mutter, hatte das Pech, denn als solches empfand sie es, am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren worden zu sein. Die englischsprechenden Menschen nennen diesen Tag häufig noch Boxing Day. Denn früher beschenkten die Reichen ihre armen Nachbarn und die “Herrschaften” ihre Dienerschaft am 26.12. Man gab Essen, Kleidung, Spielzeug für die Kinder oder einfach Geld. Da man die Gaben verpacken musste und auch nicht jeder Unbeteiligte sehen sollte, was geschenkt wurde, tat man sie in Schachteln.
Mutter Weihnachten 1928
Als Kind bekam meine Mutter nie irgendwelche Schachteln zum Geburtstag. Meine Oma legte einfach alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum, sie dachte praktisch. Doch meine Mutter hatte das Gefühl, anderen Kindern gegenüber im Nachteil zu sein. Nicht nur bekam Käte keine Geschenke an ihrem Ehrentag, auch die Gratulation in der Schule verpasste sie, den es waren ja immer Ferien. Am schlimmsten war es aber für sie, dass sie keine Blumen bekam. Wenn sie reklamierte, antwortete die nüchtern denkende Oma: “Kind, du hast einen Weihnachtsbaum”, worauf meine Mutter regelmäßig in Tränen ausbrach. Obwohl Käte, wie man auf dem Kinderfoto sieht, reich beschenkt wurde, entwickelte sie ein kleines Geburtstagstrauma.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater Anfang der 1960er Jahre, an jedem 25.12. mit dem Auto quer durch die Stadt fuhr, um irgendwo einen schönen Blumenstrauß zu erstehen. Damals konnte man ja noch nicht an jeder Tanke Blumen kaufen. Meistens nahm er mich mit, wenn er sich auf diese Expeditionen aufmachte. Wir fuhren zum Bahnhof Zoo, da hatten immer alle Geschäfte zu, wir klapperten die großen Krankenhäuser ab, dort hatte manchmal ein Florist offen, wenn garnichts funktionierte, probierten wir es am Flughafen Tempelhof. Zwischendurch machten wir Rast in einer “Arweiterkneipe”, wie es mein Vater nannte. Papa trank ein kleines Bier und einen Schnaps und ich bekam Limo oder Eis. Mir machten diese Akquisitionstouren Spaß, meinem Vater auch. Er hätte natürlich am Vormittag des Heiligen Abends Blumen kaufen und sie verstecken können, aber das hätte jeder Dramatik und einer großen Geste entbehrt. Und mein Vater war schließlich ein Schauspieler mit ausgeprägten dramaturgischen Ambitionen.
Mutter, gebauchpinselt
Meine Mutter war auch glücklich, sie fühlte sich “gewertschätzt”, würden wir heute sagen, sie hätte wahrscheinlich “gebauchpinselt” gesagt. Ihr ganzes Leben achteten wir immer darauf, ihr mehrere Geschenke zu besorgen, am besten 3 oder 4 und sie sorgsam in Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke aufzuteilen und Blumen durften auch nie fehlen, bis sie zu Weihnachten und ihrem Geburtstag 2004 ein letztes Mal gebauchpinselt wurde. Marcus Kluge.
Brüder, eingestimmt
Bruder, glücklich mit neuem Roller
Mutter, stimmungsvoll vorlesend
Vater, glücklich mit meinem Bruder und (u.) glücklich mit neuer Fototechnik
Kurz vor Weihnachten 1990 stirbt meine/unsere Katze Pünktchen. Meine Tochter malt es, zusammen mit Kater Dieter winkt sie Pünktchen im Himmel zu. Merke: auch im Katzenhimmel gibt kleine Weihnachtsbäume und natürlich für jede Katze einen Freßnapf mit dem eigenen Namen.
—
„Athener Grill, Far-Out und Uhrwerk Orange” / Mendelsohn-Bau Lehniner Platz – Lost and Found

1969 schleppte mich ein Schulfreund mit zur Roten Garde, einer maoistischen Jugendorganisation. Als er die Adresse nannte, fragte ich nach, gab es wirklich einen Platz in West-Berlin, der nach dem russischen Revolutionär benannt war: Leniner Platz? Nein, natürlich nicht, Lehnin bei Brandenburg war der Ursprung, doch das Umland hatte man nicht auf dem Schirm in den Mauerjahren.
Die Rote Garde hatte Räume im Mendelsohn-Bau, der in den 1920er Jahren als Woga-Komplex erbaut wurde. Doch die drögen Schulungen und humorfreien Diskussionen bei den Gardisten konnten mich nicht begeistern. Eher begeisterte mich die Architektur der Neuen Sachlichkeit und die Blechpizza, die ich am Lehniner Platz zum ersten Mal aß. Das schicke Restaurant “Ciao” hatte eine gehobene, häufig prominente Klientele. Neben dem Eingang war ein Fenster, dort konnte man für eine Mark ein Stück der äußerst leckeren, neuen Backware “Mark-Pizza” erwerben. Man kannte zwar Spaghetti und Makkaroni, aber Pizza war noch eine seltene Spezialität, es würde viele Jahre dauern, bis man Pizza im Supermarkt kaufen können würde. Inzwischen werde ich von jungen Menschen gefragt was denn “Mark-Pizza” gewesen wäre. So schnell vergeht die Zeit.
Oben: Das Ciao in den 70er Jahren, im November 2016 fand ich dort ein Kebap-Grillhaus namens Black&White Istanbul.
Der WOGA-Komplex (https://de.wikipedia.org/wiki/WOGA-Komplex_am_Lehniner_Platz) wurde von Erich Mendelsohn zwischen 1925 und 1931 erbaut. Er stellt eine Verbindung aus Kulturstätten, Einkaufsmöglichkeiten und Wohngebäuden dar. Der Komplex wird stilistisch der Neuen Sachlichkeit zugeordnet. Begibt man sich am Ende des Kurfürstendammes auf den Lehniner Platz, fallen einem zwei ausladende Kopfbauten auf, in deren Mitte sich eine kleine Ladenstraße befindet, die auf ein querstehendes Gebäude zuläuft. Hieran schließt sich eine Wohnanlage mit Grünflächen und Tennisplätzen. In einem der beiden Kopf-Bauten ist aktuell die Schaubühne untergebracht. Der WOGA-Komplex steht unter Denkmalschutz. (Nach WiKi)
Mich zog es immer wieder zum Mendelsohn-Bau. 1970 gab es neben den Kinos noch einen Theatersaal, in dem ich eine Aufführung des Musicals “Hair” sah. Im “Ciao” ging ich mit meiner Cousine Ingrid essen, weil wir keine Promis waren und auch keinen teuren Wein bestellen wollten, behandelte man uns ziemlich von oben herab. In meinem ersten Roman “Xanadu ’73” verarbeite ich das Erlebnis:
Sie laufen den Kudamm in Richtung Halensee und Hanna fragt, halb besorgt, halb scherzhaft:“Du willst mich aber nicht in den Athenergrill ausführen?“ Er schüttelt den Kopf, tatsächlich ist ihm die Frage peinlich, er wird sogar ein wenig rot. Wenige Meter hinter dem Athenergrill, hält er ihr eine Tür auf. Ins “Ciao” lädt er sie ein. Einen schicken Italiener, wo man manchmal sogar Schauspieler oder andere Prominente sieht. Schon ist der Kellner da, wieselt um die beiden, radebrecht, „Einen Tisch, a due?“ Beaky nickt und der Kellner will sie ganz hinten im Lokal platzieren, Hanna stoppt ihn souverän. Sie will am Fenster sitzen, was auch kein Problem ist, der Laden ist fast leer.
Hanna hat nur eine rosafarbene Weste und nichts zum Ablegen an, Beakys Fransenlederjacke will ihm der Kellner abnehmen, es gibt etwas Gezerre und Beaky gewinnt das Match. Einen Freund haben sie in ihrem Kellner nicht gewonnen mit diesem Entrée.
Jetzt bringt der Kellner Beaky die Weinkarte, davon lässt er sich nicht irritieren, man hat ihn vorgewarnt. Weltmännisch sucht er einen bezahlbaren Wein aus, auch das probieren und freundlich Nicken bekommt er hin. Aber er fühlt sich überhaupt nicht wohl und schließlich gesteht er sein Missempfinden Hanna, die sieht es ähnlich. Als sie Beaky darauf hinweist, dass der Kellner einen ganz anderen, teureren Wein gebracht hat, kommt Beaky eine spontane Eingebung, Er bedeutet Hanna ihr Glas auf Ex zu trinken, dann zerrt er sie hoch, greift seine Jacke, schleust sie durch den Eingang auf den Gehsteig. Sie rennen los, er hat sich vorher versichert, das sie keine Absätze trägt. So jagen sie den Kudamm hoch zurück in Richtung Leibnizstraße und kichern. Als sie an der Ecke Eisenzahnstraße sind, blicken sie zurück und sehen den gestikulierenden Kellner, worauf sie einen erneuten Lachanfall bekommen. Sie halten sich die Bäuche und lachen bis es wehtut.
Im Studio-Kino sah ich Zappas “200 Motels” und “Clockwork Orange”. Bei letzterem erlitt ein Freund, Connie, einen Panikanfall, den ich im Roman, als eine Drogenüberdosis schildere:
Der ausgezeichnete Film fesselt mich erneut. Ich verfolge die bösen Taten des Helden und leide mit ihm, als er in den Knast kommt. Als Alex schließlich eine Aversionen erzeugende Droge gespritzt bekommt und festgeschnallt stundenlang “horrorschaumäßige” Filme ansehen muss, fällt mir auf, dass Beaky neben mir mit schreckgeweiteten Augen auf die Leinwand starrt und seine Fingernägel in die Oberschenkel drückt. Er wirkt wie ein Spiegelbild von Alex. Ich frage ihn und erst später wird mir bewusst, dass das eine ziemlich blöde Frage war: “Bist du OK?” Statt zu antworten schüttelt er den Kopf. Ich zerre ihn aus der Stuhlreihe, wir verlassen den Saal und finden uns in einem der runden Gänge, die um die Säle herum führen. Beaky ist noch bleicher geworden und mir fällt auf, dass er Stecknadelpupillen hat.
Ich verwerfe meine erste Theorie, nach der Beaky eine Panikattacke erlitten hat. Ganz offensichtlich hat er auf dem Klo noch weitere Drogen genommen, wahrscheinlich hat er ein Opiat gespritzt. In den frühen 70er Jahren dachte man relativ schnell an Heroin, weil es in Berlin billig und leicht zu beschaffen war.
Nina Hagen scheint den Lehniner Platz auch zu mögen, nach ihrer Übersiedlung in den Westen gab sie hier ein Konzert, umsonst und draußen. Ich glaube, es müsste 1978 gewesen sein, dass ich sie dort live, mit der Nina Hagen Band, gesehen habe.
Oben: Postkarte aus den 50er Jahren. Unten: Illu zum Kapitel “Uhrwerk” aus “Xanadu ’73” von Rainer Jacob.
In den 70er und 80er Jahren besuchte ich häufig, wie alle Nachtschwärmer dieser Zeit, den “Athener Grill”. Die Berliner sprachen den Namen aus, als ob es ein Wort wäre, Athenergrill, betont auf der zweiten Silbe: A-THÉ-nergrill! Auch diesem Etablissement widme ich einen Abschnitt im Xanadu-Roman.
Beaky und ich laufen zurück in Richtung Lehniner Platz, um im Athenergrill, dem wahrscheinlich beliebtesten Selbstbedienungsrestaurant dieser Jahre, einzukehren. Ich bin dort immer wieder gewesen bis in die 90er Jahre, als ich eine Kakerlake in aller Ruhe durch die Vorspeisenvitrine laufen sah. 1973 habe ich noch Vertrauen in die Restauration und hole mir zwei von den kleinen Mimis Dönern in Pita-Brot, die damals 1.50 kosteten. Beaky isst eine quietschsüße, griechische Angelegenheit aus Joghurt und Honig, auch das bestätigt meine Idee, das er vor allem dem Heroin zugetan war. Denn alle Heroin-Junkies, die ich kennenlernte waren Süßschnäbel, wieso auch immer. Ich trinke Fanta dazu und Beaky schwarzen Kaffee, von dem er im Lauf des Abends vier oder fünf Tassen trinkt, denn wir sitzen lange im Athenergrill. Das war ja das Gute an diesem Etablissement, es schloss nie. Irgendwann gegen morgen kamen zwei mürrische Putzfrauen und vertrieben die Gäste, aber nur für eine kurze Weile, dann kehrten die üblichen Gestalten zurück und man hatte den Eindruck, sie seien nie weg gewesen.
Es muss um 1960 gewesen sein, als wir meinen Vater ins Albrecht-Achilles-Krankenhaus brachten, der sich einer Operation unterziehen musste. Die Klinik gibt es nicht mehr, heute residiert hier das Finanzamt Wilmersdorf.
1983 fotografieren Rainer Jacob und ich die Band “Dreidimensional” am Mendelsohn-Bau für meine Zeitschrift “Assasin”. Sie kommen sogar auf das Cover des zweiten Heftes. Obwohl die Spandauer Musiker sehr jung, fast kindlich wirken, erinnern mich die Bilder regelmäßig an “Uhrwerk Orange” und den Panikanfall meines Freundes in den 70er Jahren.
Diverse Kneipen und Clubs haben den Lehniner Platz zum Anziehungspunkt für die wechselnde Klientele der Jugendgruppierungen gemacht. Mitte der 70er Jahre trafen sich die ersten Berliner Punks im PunkHouse neben dem Athener Grill, wo heute ein öder Spielsalon zum Geld verlieren einlädt.
In der ehemaligen Ladenstraße gab es Berlins einziges Rollschuh-Diner “Mendelsohns”, davor war es ein “Treibhaus”, sowie eine Version des umtriebigen Tolstefanz und dann lange, die bei Bagwan-Jüngern beliebte Disco “Far-Out”.
In den 90er Jahren war ich noch ein paar mal am Lehniner Platz. Ich besuchte eine Botho Strauss-Inszenierung in der Schaubühne. Die Gesellschaftselite, die Strauss vorführt und als langweilig und uninspiriert kritisiert, war als Inszenierung genau das: langweilig und uninspiriert. Die Zeiten, da die Schaubühne mich begeisterte schien vorbei und auch der Athener Grill wurde nie wieder mein Ziel, nachdem ich das erwähnte Krabbeltier in der Vorspeisenvitrine beobachtete.
Inmitten der Wohnanlage befinden sich Tennisplätze, auf denen Prominente, wie Erich Kästner, der in der Nähe wohnte, oder Willy Brandt, als er Regierender Bürgermeister war, spielten. 2007 musste der letzte Pächter die Plätze aufgeben, nachdem ein Investor unrealistische Summen für die Pacht verlangt hatte. Das Bauvorhaben des Investors ist dieses Jahr vom Bezirk abgelehnt worden, so dass wieder Hoffnung besteht, die charmante Sportanlage wieder nutzbar zu machen. In ebenfalls bedauerlichem Zustand ist das Postamt Nestorstraße, 1930-32 von Willy Hoffmann erbaut. Der verputzte Stahlbetonriegel in Stil der Neuen Sachlichkeit mit Bezügen zur Wohnbebauung der östlich anschließenden Cicerostraße (WOGA-Komplex), bildet den nördlichen Abschluss des Hochmeisterplatzes.
Ansonsten ist der gesamte Komplex in ausgezeichnetem Zustand, unten die Wohnanlage Cicerostraße und darunter das Apartmenthaus in der Mitte des WOGA-Komplexes.
Oben: Der Ausführungsplan des Woga-Komplexes von 1927. Quelle: – Von SL1974 (S.Lucht) – von ihm selbst erstellt; Original-Ausführungsplan von 1927 ist im Besitz der Kunstbibliothek, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin; abgelichtet in Pitz, Helge: Der Mendelsohn-Bau am Lehniner Platz, Berlin 1981, S. 42., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3292680 –
Text und Fotos: Marcus Kluge (s.u.)
Von der Erstausgabe des Romans “Xanadu ’73” gibt es noch einige Restexemplare. Bestellbar bei mir, unter marcusklugeberlin@yahoo.de für 13€ inkl. Versand in Deutschland.
Berlinische Leben: “Kneipe mit Bewusstsein”/ von H.P. Daniels / West-Berlin 1972

Schlaff saß zwischen den Schränken, nein, zwischen Schrank und Kachelofen: eingeklemmt.
“Hahaha Klaustro-Klause, Schlaff, sitzt du gut in deinem Eckchen. Mann, hast du n Glück, dass der Winter vorbei ist, dass der Ofen nicht mehr geheizt werden muss. Sonst würdest du da jetzt schön schmoren, in deiner Klaustro-Klause, was, Schlaff? Wie heizt man überhaupt son Ding, son Kachelofen?”
“Keine Ahnung. Mit Kohlen, oder? Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Iss ja noch ne Weile hin…”
“Ach ja, Richard, denn sehn wir uns ja öfter jetzt, wa? Vielleicht hilft DER dir ja mit dem Ofen. Warum sagen die Berliner eigentlich immer ‘wa’?”
“Weeß ick doch nich, warum die wa sagen, wa?”
“Omi hat auch immer wa gesagt. Omi am Büdchen.”
“Welche Omi? An was für nem Büdchen denn?”
“Omi am Büdchen in Kelkheim. Bei unserer Schule, gleich um die Ecke. Wir haben sie Omi genannt, weil sie schon ein bisschen älter war und was Omihaftes hatte. Zu Omi sind wir immer in der Pause. Ans Büdchen. Eine rauchen. Ne Cola trinken, oder so was. So ne typische Bude, mit Zeitungen, Zigaretten, Getränken, Süßigkeiten, kleine Sachen zum Essen, Brötchen, und ich glaube sogar auch Würstchen … heiß gemacht. Die Arbeiter von der Möbelfabrik und den Schreinereien sind da auch immer hin. Omi war Berlinerin. Und sie hat immer wa gesagt. An jeden Satz hinten dran gehängt. Daher kannte ich das schon. Habta wieda Pause, wa? Kommta wieda roochn, wa? Omi war immer nett mit uns Schülern…”
“Aha, ist ja sehr interessant! Spannende Geschichte. Kelkheim … KELK-HEIM, dieses Furzkaff, diese Provinzler da. Da kann man ja nichts Spannenderes erwarten!”
“Jetzt bist du ja in Berlin, Richard, was für ein Glück, da sehn wir uns ja jetzt öfter, Richard, wa?”
“Jaaaa, iss ja gut! Überlegt euch lieber mal, was wir heute Abend machen wollen.”
“Quasimodo!” schlägt Schlaff vor. “Wir könnten ins Quasimodo gehen.”
“Nee, also ins Quasimodo geh ich heute nicht mehr. Das ist doch ein scheißbürgerlicher Spießerladen. Touristenkneipe. Wenn ihr da hingehen wollt, bitte, dann geht da von mir aus hin, passt ja auch irgendwie zu euch Spießern. Aber ich komm da nicht mit, mir ist das zu blöd. Ich geh woanders hin?”
“Und, wo gehst du hin, Rikki?”
“Ich will in eine richtige Kneipe. Ne linke Kneipe mit dem richtigen Bewusstsein. Was Politisches…”
“Und wie soll diese Kneipe aussehen? Mit dem richtigen Bewusstein. Kneipe mit Bewusstsein? Wo soll die sein? Wir fanden das Quasimodo ganz gut…”
“Das ist doch was für Kleinbürger. Macht, was ihr wollt, ich such mir ne ideologisch einwandfreie Kneipe.”
Petty lachte laut. “Haha, Rikki, eine ideologisch einwandfreie Kneipe! Hast du das gehört, Schlaff? In eine ideologisch einwandfreie Kneipe will Rikki, ideologisch einwandfrei … das würde mich ja dann auch mal interessieren. Was eine ideologisch einwandfreie Kneipe ist. Da kommen wir mit, das will ich sehen. Komm Schlaff, kommt Verdammte dieser Erde, Rikki führt uns an, ihm nach. Rikki, unser großer Steuermann. Avanti Populo, Rikki, zeig uns den Weg zur ideologisch einwandfreien Kneipe! Führ uns an, Genosse, auf dem langen Marsch!”
“Redet doch nicht son Unsinn”, sagte Rikki, “ich weiß was, ich weiß wirklich was. Ich weiß, wo wir hingehen.”
Er kramte in einer Kiste, in einem Stapel alter Zeitschriften. “Agit 883” hieß die Zeitung die er hervorzog. Komischer Name. So eine typische Alternativzeitung mit wilder Aufmachung, Schreibmaschinen-Layout.
“Schaut mal, hier sind ein paar Annoncen. Er blätterte und suchte.
“Black Korner … das klingt doch schon mal ganz gut … Nassauische Straße? Wo issn die Nassauische Straße?”
“Zeig mal her, Rikki. Korner mit K? Haben die sich nach Alexis Korner benannt? Den Vater des englischen Blues?”
“Das denkst auch wieder nur du, in deiner halb verblödeten Kiffer-Birne … dass alle sich nach irgendwelchen Bands und Musikern benennen müssten. Blues, ha Blues, was fürn langweiliger Scheiß. Wenn du mich fragst, ich stehe nur auf Tyrannosaurus Rex. Das ist ne Band. Das ist die Musik der Zukunft. Aber du und Schlaff, ihr mit eurem öden Blues, mit eurem Ten Years-After-Langweiler-Zeugs…”
“Ja, genau, Rikki … Klickelwutt Glien … die fandst du doch auch immer gut?”
“Ja, okay, Klickelwutt Gliehn, aber auch nur wegen des chinesischen Titels. Klicklwutt Gliehn. Nur das Wortspiel fand ich gut, nicht die Musik. Und ‘Zehn Jahre Arsch’ finde ich auch immer noch ganz lustig … für Ten Years After. Aber musikalisch ist für mich nur noch Tyrannosaurus Rex relevant.”
“Ne, Rikki, wirklich nicht. Ich will nur noch ideologisch einwandfreie Bands hören. Aber was ist jetzt mit der ideologisch einwandfreien Kneipe?”
“Na ja, Black Korner ist wohl doch nicht so. Schau mal hier, was hier steht: ‘Psychothek’ steht hier. Was solln das sein? Das klingt doch wieder nach so nem Kifferscheiß. Eher was für euch. Unpolitischer Kifferscheiß.”
“Schau mal, hier ist noch was. Was ist das denn? ‘Tina Putt – Brutstätte für Farbeierablage von Blauhelmen. Zur Wanne’. Heißt das jetzt Tina Putt? Oder Zur Wanne? Holsteinische Straße? Wo issn die?”
“Keine Ahnung, aber klingt doch schon besser als dieser Psycho-Scheiß. Psychedelic-Scheiß. Das wäre eher was für den Nowak: noch drei Trips bis Wochenende! Wisst ihr noch: der Nowak … Immer LSD. Aber hier ist noch was. Schaut mal: Das wäre doch was? ‘Drehscheibe. Undogmatische Kneipe für linke Leute’. Das ist’s doch genau das, was wir suchen. Und hört mal: 20 in- und ausländische Tageszeitungen, 40 Zeitschriften, 7 verschiedenen Biere, 7 Wodka-Sorten, 4 Fernsehprogramme. Das ist doch wirklich was, da gehen wir hin. Pfalzburger Straße 20. Gib mal den Stadtplan.”
Sie suchten die Pfalzburger Straße.
“Schau mal hier. Die is ziemlich lang. Wo isn die Nummer?”
“Die 12 ist hier. Aber da auf der anderen Seite ist schon die 71. Wie kann das denn sein? Ist der Plan falsch?”
“Weißt du das nicht? Hier in Berlin ist doch alles anders. Hier haben sie ein völlig bescheuertes System, die Straßen zu nummerieren. Da gibt’s nicht die geraden Nummern auf der einen Straßenseite und die ungeraden auf der anderen. Nee, da zählen sie auf der einen Seite die ganze Länge lang rauf, und dann am Ende auf der anderen Seite weiter, also wieder zurück.
“Wie jetzt? Weiter? Oder zurück?”
“Na ja auf der einen Seite rauf und die andere Seite wieder runter.”
“Versteh ich nicht.”
“Mann, Petty, du kapierst auch wieder überhaupt nichts. Das kommt von eurer bescheuerten Kifferei. Also ich erklär’s dir nochmal.” Er deutete auf den Stadtplan. Pfalzburger Straße. “Schau, hier fängt sie an zu zählen, an der Lietzenburger Straße, da fängt sie an. Also hier auf der linken Seite ist die Nummer 1. Das heißt: eigentlih ist es ja die rechte Straßenseite. Dann zählt sie 1,2,3,4,5,6 und so weiter. Hier ist die 17, da die 26, da die 28, siehst du? Und hier am Ende, wie heißt die Straße da? Fechnerstraße, ja, da geht’s dann auf der anderen Seite weiter. Schau, hier ist die 44, da die 55, 79 und wieder bis rauf zur Lietzenburger Straße. Da liegt dann das Haus mit der höchsten Nummer dem mit der 1 gegenüber.”
“Seltsames System! Warum machen die das?”
“Sag ich dir doch: weil sie bescheuert sind. Da kann man sich dumm und dämlich suchen nach einer Hausnummer.”
“Und wo ist jetzt die Pfalzburger 20?”
“Hier ist die 17 und da ist die 26. Müsste also ungefähr dazwischen sein. Hier vielleicht. Da fahren wir am besten genauso wie gestern, steigen aber schon am U-Bahnhof Spichernstraße aus. Von da können wir dann zu Fuß rüber laufen.”
“Aaah … nicht so viel laufen!”
“Hör auf, Schlaff, du wirst doch wohl mal ein paar hundert Meter laufen können! Wenn die Revolution kommt, wirst du schon auch mal rennen müssen. Kannst ja jetzt schon mal ein bisschen trainieren!”
Spichernstraße steigen sie aus.
“Komische Gegend. Schau mal da oben, auf diesem hässlichen Betonneubau. Was ist das denn? Soll das der Kopf von Jimi Hendrix sein?”
Sie schauen hoch auf den langgestreckten Neubau, da ist der Kopf eines Langhaarigen, schwarz wie ein Scherenschnitt auf transparentem roten Hintergrund, von hinten beleuchtet. Das hat etwas Ikonenhaftes, wie das berühmte Bild von Che Guevara mit Bart und Baskenmütze. Das Rikki in seiner neuen Wohnung, dieser Rumpelbude, über dem Sofa hängen hat.
“Ist das Hendrix?”
“Nee, Frank Zappa, oder?”
“Quatsch, das ist nicht Zappa! Zappa sieht anders aus. Zappa hat doch auch den Bart!”
“Hat der da oben doch auch!
“Nee, hat er nicht. Schau doch mal hin.”
“Aber Hendrix? Ein bisschen sieht er schon aus wie Hendrix. Hmm … vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gar niemand. Jedenfalls niemand Spezielles. Einfach nur ein Langhaariger. Ein Freak.”
“Weißt du, Zappa oder Hendrix, mir ist das völlig egal. Das nimmt sich doch sowieso nichts. Ist doch alles das Selbe. Alter Mist von gestern. Tyrannosaurus Rex, das ist was. Das ist die Musik der Zukunft. Ihr werdet sehen. Ich sag’s euch. In ein paar Jahren werdet ihr an mich denken.”
“Mann Rikki, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist … wenn wir uns jetzt öfter sehen.”
“Das ist ne Werbung für diesen Laden da oben. Ist der da oben drin? In diesem hässlichen Haus? Schau mal, diese riesigen bunten Buchstaben da am Haus: B-I-G-A-P-P-L-E. Big Apple? Ist das ne Disco?”
“Big Apple gibt’s in München auch. Auf der Leopoldstraße. Gleich neben dem PN. Das PN war immer beliebter, weil da meistens die besseren Bands gespielt haben. Kinks, Pretty Things, Boots, Renegades. Hendrix hat da auch mal gespielt. Ganz am Anfang seiner Karriere, als ihn noch keiner kannte. Oder hat der im Big Apple gespielt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Jedenfalls hab ich zuletzt im Big Apple Golden Earring und Man gesehen. Ist noch gar nicht so lange her…”
“Mann, Petty, das interessiert doch keine Sau, deine öden Kifferbands.”
“Ja, ich weiß, Rikki, Tyrannosaurus Rex … aber die gibt’s ja eigentlich schon gar nicht mehr … heißen die nicht inzwischen T.Rex? Und wo geht’s jetzt hier eigentlich zur ideologisch einwandfreien Kneipe?”
Sie liefen ein Stück, suchten ein bisschen, und gerade als Schlaff zu maulen anfing: “Wo issn das jetzt … ist das noch weit?” … fanden sie die Drehscheibe.
Sie setzten sich rechts hinter der Tür an einen runden Tisch. Und bestellten Bier. Schlaff rauchte eine Gauloise, Rikki und Petty rauchten Reval. Ein paar Freaks liefen herum, rauchten Selbstgedrehte, ein paar langhaarige Gestalten. Und ein paar ältere Typen, die nach schwerer politischer Diskussion aussahen. Links neben der Tür stand ein großes Regal, mit unzähligen Zeitungen und Zeitschriften. Rikki wühlte da ein bisschen herum, schaute, blätterte.
“Ah, die Agit 883 gibt’s hier auch. Und was ist denn das hier für ein Blättchen?” “Berliner Extra-Dienst”, ein einfach hergestelltes Heftchen im winzigen DIN A 5 Format.
“Das ist doch interessant”, fand Rikki, “Obwohl die Aufmachung ja auch nicht gerade der Hit ist, ein bisschen mickrig, oder? Das könnte man doch besser machen. Und haben sie dieses Logo hier absichtlich ein bisschen an die Bild-Zeitung angelehnt? Ja, das ist gut, das ist ironisch gemeint. Das ist ganz gut!”
Schlaff und Petty fanden die ganze Kneipe ein bisschen muffig, eher öde. Langweilig.
“Und? Bist du jetzt zufrieden, Rikki? Ist die Kneipe ideologisch einwandfrei genug? Diese undogmatische Kneipe für linke Leute? Ist doch irgendwie langweilig, oder?
“Jetzt spielt euch mal nicht so auf. Immerhin haben sie Zeitungen hier. Viele Zeitungen Und vor allem linke Zeitungen. Das ist doch was.”
“Wie weit ist es denn von hier zum Quasimodo?” wollte Schlaff wissen, “das kann doch nicht so weit sein?”
“Ja, da können wir zu Fuß gehen. Wir haben ja einen Plan dabei!”
Schlaff maulte: “Zu Fuß? Wie weit denn?”
Rikki war einverstanden. Kein leichter Weg für beide.
“Ideologisch einwandfreie Kneipe, hahahah, Rikki. Das war also die ideologisch einwandfreie Kneipe. Sehr schön. Wunderbar. Ideologisch einwandfrei … aber total langweilig. Keine Musik, keine Zeichentrickfilme und keine Frauen. Was ist Rikki, fandst du die ideologisch einwandfreien Frauen hier besser als gestern im Quasimodo?”
“Immerhin gab es Zeitungen!”
“Ja, ja, Richard, vielleicht sehn wir uns ja jetzt öfter. In einer ideologisch einwandfreien Kneipe! Da könn wa denn so manche Molle zischen miteinanda, wa?”
“Ach Petty, hör doch auf!”
Agit 883 56 51, später zum geläufigeren Agit 883 verkürzt, war eine anarchistisch-libertäre Zeitschrift aus der Linken Szene West-Berlins, die mit wechselnden Untertiteln und in wechselnder Zusammensetzung der Redaktion von Februar 1969 bis Februar 1972 erschien. Sie gilt in Bezug auf die gewählten Themen, ihre Sprache und die Aufmachung (Illustrationen mit Fotomontagen und Comics, libertäre Agitation) als typisches Blatt der späten Studentenbewegung. Die Zahl im Titel der Zeitschrift war die Telefonnummer der Redaktion bzw. der Wohngemeinschaft und des Mitherausgebers Dirk Schneider in der Uhlandstraße 52 in Berlin-Wilmersdorf. (Quelle: WiKi)
Die Titelbilder stammen von dieser Website mit Scans aller Ausgaben:
Berlinische Leben – „Im Quartier von Quasimodo“ / von H.P. Daniels / Reblog

West-Berlin 1972.
Sie wollten mal nach den Kneipen schauen. Die Lage erkunden. Abgefahrene Studentenkneipen gibt’s doch hier wie Sand am Meer. Sie wollten mal schauen.
“Am besten wir fahren ins Zentrum”, sagte Rikki. “Bahnhof Zoo, die Gegend, Gedächtniskirche, Kudamm, da finden wir bestimmt jede Menge guter Kneipen.”
Rikki hatte einen Plan. Mit dem Bus ein paar Stationen bis Hermannplatz.
Schlaff sagte: “Herrmannsplatz”.
“Mann, Schlaff, Mann, wie oft soll ich’s dir noch sagen: der heißt nicht Hermannsplatz. Der heißt Hermannplatz. Merk dir das doch endlich mal!”
Sie fuhren ein Stück. Auf dem Oberdeck vom Doppeldeckerbus durfte man rauchen.
“Ist doch toll hier, was? In Berlin darf man sogar im Bus rauchen! Allerdings nur oben. Aber immerhin.”
“Hermannsplatz! Wir müssen raus”, sagte Schlaff und stand auf, “kommt, wir müssen raus!”
Rikki rollte mit den Augen. Herrmannsplatz … der merkt sich das nie! Sie stiegen aus. Und runter in die U-Bahn.
Sie schauten auf den Plan. “Berliner Straße müssen wir umsteigen!” Sie stiegen um. Richtung Zoo. Sie stiegen aus. Sie gingen rauf. Wo waren sie hier? Sie sahen sich um. Alle Richtungen.
Rikki gab den Berlin-Experten: Schaut mal hier, schaut mal da, Petty kam sich vor wie ein bescheuerter Tourist.
“Also wohin jetzt?”
“Weiß ich doch nicht!”
“Du bist doch der Berlin-Experte!”
“Wieso ich?”
“Weil du hier wohnst!”
“Na ja, so lang ja nun auch wieder nicht.”
“Immerhin wohnst du hier. Und wir nicht.”
“Na, so richtig wohne ich doch auch erst seit vorgestern hier. Seit meine Klamotten hier sind. Das Vorher zählt doch nicht.
“Aber dann spiel dich auch nicht immer auf als den großen Berlin-Experten! Also wohin jetzt?”
“Weiß ich doch nicht!”
“Ich dachte, du kennst hier alles? Alle tollen Kneipen. Was hast du denn hier die ganze Zeit gemacht?”
“Was heißt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Was hab ich gemacht? Wohnung gesucht. War schwierig genug…”
“Tssi, Tssi, Tssi. Jetzt streitet euch doch nicht schon wieder…”
Schlaffs gutmütige hohe Kinderstimme.
“Und was ist das da drüben eigentlich? Worauf warten die denn?” Schlaff deutete auf eine riesige Menschenschlange unter der Eisenbahnbrücke. Vorwiegend junge Typen, Freaks, lange Haare, Hippies, Anarchos. Aber auch andere, eher Normale. “Was machen die da?”
“Schlaff, die suchen ne Wohnung!”
Rikki war wieder in seinem Berlin-Experten-Element:
“Die warten auf die Zeitung. Die Morgenpost!”
“Warum das denn? Zeitung? Abends um diese Zeit?”
“Ach, du kapierst mal wieder gar nichts. Die stehen da alle, weil um zehn der Typ mit der Morgenpost kommt. Der ist der Erste, der schon die Zeitung vom nächsten Tag verkauft. Wo die ganzen Wohnungsanzeigen drin sind.”
“Und warum können die nicht bis zum nächsten Tag warten? Um die Zeit bekommen die doch sowieso keine Wohnung mehr, oder?”
“Mann, Schlaff, du begreifst es nicht. Also pass auf, ich erklär’s dir: Um zehn kommt hier die Morgenpost mit den Wohnungsanzeigen. Und weil alle möglichst schnell an die Annoncen rankommen wollen, stehen sie hier und warten. Schon lang bevor der Zeitungsmann da ist. Und dann geht das so: Man kommt am besten immer zu zweit. Einer stellt sich an für die Zeitung. Der andere besetzt eine Telefonzelle. Siehst du die Telefonzellen da an der Ecke? Alle besetzt. Die warten auch. Sobald die Zeitung da ist, rennen sie zur Zelle und schauen die Anzeigen durch. Die sind sortiert nach Wohnungsgrößen. Also, wenn du ne Zweizimmer-Wohnung suchst, schaust du da. Die meisten suchen Einzimmerwohnungen, weil die am billigsten sind. Oder sie suchen besonders große Wohnungen, für ne Wohngemeinschaft…
“Wie du jetzt demnächst für uns, Rikki…”
“Ach lass mich in Ruhe mit dieser Wohngemeinschaftswohnung. War schwierig genug, die Einzimmerbude in Neukölln zu kriegen…
“Und dann?”
“Dann, wenn sie ne interessante Anzeige gefunden haben, rufen sie da an … sofort.”
“So spät am Abend noch?”
“Ja, Mann, das musst du, sonst hast du keine Chance!”
“Ach, dieses Berlin ist schon komisch … Und ein bisschen anstrengend, oder?”
“Was heißt hier komisch, Schlaff, was heißt anstrengend? Berlin ist einfach so, das ist hier so. Das ist eben ne richtige Großstadt. Nicht son Pisskaff wie Frankfurt. Oder das noch pisskäffigere Bad Soden. Oder Hofheim. Oder Kelkheim. Oder Eppstein. Oder Niedernhausen. Mann bin ich froh, dass ich endlich weg bin aus diesen Pisskäffern. Diesen elenden Provinznestern!”
“Und wohin gehen wir jetzt?”
“Weiß ich doch nicht. Wir können ja jemanden fragen.”
“Was willste denn fragen?”
“Na ja, wo hier ne gute Kneipe ist. Wir fragen jetzt einfach irgendjemanden. Irgendeinen Freak, der hier vorbeikommt. Da ist doch schon einer. Der sieht doch okay aus, der weiß bestimmt Bescheid. Da issn Freak.”
Rikki fragte nach einer guten Kneipe. Hier in der Nähe.
“Hier in der Nähe? Hmm.” Der Freak dachte nach. “Kommt drauf an, was ihr sucht. Was sucht ihr denn?”
“Na ja, ne gute Kneipe halt. Ne Studentenkneipe. Wo wir n Bier trinken können. Nicht so was Bürgerliches. Auf keinen Fall was Bürgerliches. Eher was Flippiges. Freakiges…”
“Hmm”, der Freak dachte weiter nach: “Hier in der Gegend?”
“Ja, möglichst nicht so weit.”
“Hmm.”
Plötzlich erhellte sich das Gesicht des Freaks: “Ach ja, gleich hier um die Ecke wäre was. Gleich da an der Kantstraße rechts. Und dann am Theater des Westens vorbei. Wo das Delphi-Kino drin ist. Da geht außen eine kleine Treppe runter. Quasimodo heißt der Laden. Der ist ganz okay. Da könnt ihr hin.”
“Danke. Hab ich’s doch gewusst. Dass der Freak Bescheid weiß. Da gehen wir jetzt hin!”
Sie gingen die Treppe runter: Quasimodo. Ein Kellerlokal. Ganz witzig. Und ziemlich voll. Über einigen Tischen hingen freischwingend kleine Leinwände, auf denen Zeichtrickfilme flickerten:
“Kuck mal, Tom und Jerry!”
Sie bestellten Bier. Rikki und Petty rauchten Reval. Schlaff rauchte Gauloises. Sie lachten über Tom und Jerry. Und Donald Duck. Tranken. Rauchten. Unterhielten sich über das große Abenteuer Berlin. Ja, Berlin, Berlin, Berlin! Eine tolle Stadt. Und dass sich Schlaff jetzt auch vorstellen könnte, nach Berlin zu ziehen.
“Ja, Schlaff, zieh doch auch nach Berlin. Dann wären wir schon zu sechst. Du, Rikki, Lausi, Gisela, Birgit und ich. Dann muss Rikki halt ne Sechs- oder Siebenzimmerwohnung suchen…”
“…und sich abends anstellen unter der Bahnüberführung für die Zeitung mit den Anzeigen…”
Schlaff und Petty lachten. Rikki rollte mit den Augen.
“Hört bloß auf! Und außerdem sind mir das viel zu wenig Frauen für ne Wehgeh! Was gibt’s eigentlich hier für Frauen?” Er sah sich um: “Na ja!”
“Hahaha, Rikki der große Frauenexperte. Rikki und die Frauen, hahaha, die Frauen hier haben alle auf dich gewartet, klar Rikki…”
“Ach hör doch auf. Ich erinnere nur an dein letztes großes Desaster, Petty, hahaha, die Geschichte mit der Kauppert … Conny Kauppert … von der hast du dich doch bis heute nicht erholt. Wie lang ist das jetzt her? Das ganz große Desaster, dein persönliches Waterloo … mit der Kauppert … jajaja, das große Heulen und Zähneklappern. Da schau ich mich doch lieber hier mal um. Was es hier so gibt. Aber irgendwie ist mir dieser Laden zu bürgerlich, zu normal, zu spießig, zu sehr Touristen-Schuppen. Die Frauen sind auch nicht doll. Da muss es doch noch was anderes geben in dieser Stadt…”
“Aber nicht mehr heute, Rikki. Das machen wir dann morgen. Morgen können wir uns ja noch was anderes anschauen. Obwohl: ich find’s hier ganz lustig. Ist doch gut hier.”
Das fand Schlaff auch.
Sie bestellten noch ein Bier.
“Außerdem, wenn du hier schon so rumreitest auf der Geschichte mit Conny … dann möchte ich dich doch nur mal kurz an deine Sache mit der Schubert erinnern. Was war das denn? War das kein Waterloo, Rikki, mit der Schubert? Na, wie war das noch mal … mit der Schubert? Erzähl mal…”
Rikki heulte auf:
“Die Schubert. Mein Gott, die Schubert! Erinnere mich jetzt bloß nicht an die Schubert! Außerdem ist sie da, in ihrem verdammten Provinzkaff … und ich bin jetzt hier in Berlin!”
—
Wie schon „Hauptsache Berlin“ stammt „Im Quartier von Quasimodo“ aus dem bislang unveröffentlichten Roman „Nowhere Man“ von H.P. Daniels. Der inzwischen berühmte Live-Club im Keller des Delphi-Gebäudes hieß bis zum Jahre 1975 „Quartier von Quasimodo“. Dann kam der gebürtige Genueser Giorgio Carioti, verkürzte den Namen zu „Quasimodo“ und legte das Gewicht auf Live-Konzerte, nachdem das Lokal vorher eher als Studentenkneipe betrieben wurde. Das historische Foto stammt von der Website des Clubs:
http://www.quasimodo.de
Redaktion: Marcus Kluge
Lost and Found-Marathon 2: „Schöneberg Revisited“ / Eine Spurensuche

In Teil 2 unseres Fotomarathons erinnern wir uns an die frühen 80er Jahre in Schöneberg und schauen nach, wie sich der Szene-Bezirk seitdem verändert hat. (Solange ich noch nicht wieder auf Fototour gehen kann, werde ich bis Ende Juli alle Lost and Found-Geschichten in einem Sommermarathon rebloggen. In Planung sind: Mehr Schöneberg, Kreuzberg, Mitte/Lustgarten/Schloss und Pankow.)
Der Zensor-Plattenladen neben der Blue Moon-Boutique 1983 und 2016. Unten: Heute befindet sich ein Architekturbüro in den Räumen in der Belziger Straße.

Café Mitropa
Metropol
Vinylkultstätte

Das ehemalige Café Central (Foto oben: Knut Sehrgut) und Café Swing ist heute eine Apotheke und sieht ziemlich trist aus.

22.9. 1981: “In der Nähe vom Café Berio hatte Getränke Hoffmann eine Filiale, die Schaufensterscheibe war bis auf wenige kleine Splitter, die noch im Rahmen steckten, am Boden verteilt und ein ständiger Strom von plündernden Menschen passierte das nun offene Schaufenster. Ich blieb fasziniert stehen und beobachtete das Geschehen. Obwohl ich nicht vorhatte zu klauen, betrat ich den Laden, nur um zu wissen, wie sich das anfühlte.” http://wp.me/p3UMZB-1ii
Café Berio
Slumberland
Winterfeldtmarkt
Rani
1983 kamen wir auf die Idee, jeden Dienstag im Mitropa Karten zu spielen. Das Spiel hieß Binokel und wir wurden ziemlich schief angeguckt. Gesellschaftsspiele waren sowas von uncool und dann auch noch Karten! Dazu tranken wir Weizenbier, was auch verpönt war. Heute ist “kiffen” untersagt.
Unten: Mitropa-Anzeige aus Assasin, 1983.
Deko Behrendt
Bowie-Haus
Stadtbad
Als in der Nacht zum 5. April 1986 im La Belle in der Hauptstraße 78 eine Bombe explodierte und drei Menschen tötete, schlief ich 500 Meter weiter in meiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Rheinstraße 14. Obwohl man als Berliner immer einer theoretischen Gefahr ausgesetzt war, ist der Terror selten so nahe gekommen. Die Visitenkarte drückte mir, Wochen vorher, eine hübsche junge Dame vor dem Forum Steglitz in die Hand.
Von unserem alten Domizil (oben) mit dem idyllischen Hof hinter der Leiserfiliale, Rheinstraße 14, ist nichts mehr zu finden. Nur ein seelenloser Neubau steht an seiner Stelle.
Von 1977 bis 1986 wohnte oder arbeitete ich dort. Anfang der 80er zog Herbert ein und das Gebäude wurde Redaktionssitz des Assasin. Am 10. Juli 1986 feierten wir noch meine Hochzeit auf dem Hof, wenig später wurde alles abgerissen.
So begann es: – Der Laden, in dem ich jobbte war neben einer Leiser-Schuh-Filiale und das ganze Haus gehörte Leiser. Irgendwann als ich Müll rausbrachte, fiel mir auf, dass es einen Seitenflügel gab, in dem drei Einzimmer-Wohnungen untergebracht waren. Der Seitenflügel machte einen irgendwie prekären Eindruck, man hatte ihn nachträglich an die Brandmauer geklatscht, um etwas billigen Wohnraum zu schaffen, wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts. Ich guckte mir auch den Hof genauer an, um den herum Leiser seine Lagerräume hatte. Der Hof, den offensichtlich niemand nutzte, war etwas 6 mal 30 Meter groß, den Abschluss bildete eine Terrasse, die von einem Mäuerchen zum Nebengrundstück begrenzt wurde. Eine Kastanie spendete Schatten gab dem Hof einen grünen Tupfer. Im Sommer könnte man hier bestimmt schöne Wochenenden verbringen.

Mir war klar, das die Wohnungen keinerlei Komfort boten, vielleicht war es sogar das Prekäre, das mir zusagte, mir förmlich zuflüsterte, hier wäre ein absolut passender Ort zum Leben für mich. Innerhalb von 48 Stunden mietete ich eine der Wohnungen, meine Chefin legte ein gutes Wort für mich ein, und ich zog mit meinen wenigen Sachen von der Knesebeckstraße in die Rheinstraße um. Am Anfang zahlte ich für 28qm weniger als 40 D-Mark Miete. Es war geradezu eine Einladung mich kreativ auszutoben, ohne auf die Lukrativität meiner Projekte zu achten. –
 Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.
Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.
Das Shizzo heute und damals. Das Foto unten stammt von dieser schönen Website: http://shizzo-berlin1980.de/
Kaisereiche.
Sparkassen-Kunst
MusicHall
“Die Goldenen Vampire” in der Hall.
Bewegungsmelder Kluge.
—
Schnelle Schuhe – „Landei, aufgeschlagen.“ / von Cordula Lippke – Punk in Berlin Teil 1

Heute beginne ich mit dem Reblog von “Schnelle Schuhe”, einer kleinen Reihe über Punk in der Mauerstadt. Neben den Texten von Cordula und mir werden drei weitere, neue Posts erscheinen. Zwei Artikel schildern die West-Berliner Punkszene aus der Sicht einer Spandauer Punkclique. Aufgeschrieben hat dieses Zeitdokument Olaf Kühl. Entnommen sind die Geschichten seinem, leider vergriffenen, Buch “laut und betrunken”. Außerdem erinnert sich der Musiker Sea Wanton, wie er 1983 mit seiner Band über die Transitstrecke nach West-Berlin kommt, um beim Atonal-Festival aufzutreten. Aber nun hat meine gute Freundin Cordula das Wort und erinnert sich an das Punk House, jene legendäre erste Punk-Location im West-Berlin der späten 70er Jahre. (M.K. Ob wirklich Bands wie “The Talking Heads” im Punk House gespielt haben, ist nicht zu belegen. Andere Zeitzeugen bestreiten es jedenfalls. Möglicherweise hat hier die Phantasie der Autorin einen Streich gespielt. )
(Für meinen Sohn, der gerade 19 ist und seine Jugend an der XBox verschwendet.)
1977 kam ich nach Berlin um Kunst zu studieren, eigentlich: Visuelle Kommunikation, der eben erst eingerichtete FB 4 der Hochschule der Künste (die seit 2002 Universität der Künste heißt). Meine Eltern hatten es für mich vorbereitet. Ich war schon zur Aufnahmeprüfung nach Berlin gereist, aus Bad Gandersheim, wo ich gerade mein Abitur bestanden und bei der Zeugnisausgabefeier meinen ersten Vollrausch erlebt hatte.
Berlin war mein Sehnsuchtsort aus vielen Gründen. Auch dieses Lied, das ich aus einem alten deutschen Spielfilm kannte, schwingt da mit:
“Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin … Da
gehörst du hin”* [„Der eiserne Gustav“ 1958].
Kurz zuvor war ich noch Bowie Fan gewesen. Bowie hatte mir zuerst meine Schwester im gemeinsamen Kinderzimmer vorgespielt: “There’s a starman waiting in the sky …” Das hatten wir 1972 im Chor gesungen.
1971 besuchten wir als Familie Berlin. Wir waren mit dem Flugzeug in Tempelhof gelandet, im Zoo und in Ost-Berlin gewesen und konnten einem Selbstmörder beim Nichtspringen vom Europa-Center zuschauen.
Ich hatte die Nase voll von den irritierten Blicken der Kleinstädter und Kurgäste, wenn meine roten oder blauschwarzen Haare, meine schrille selbstgeschneiderte Kleidung (eine Hommage an meine Oma Alwine, die immer alles selbst genäht hatte), ihr Weltbild störten. Im Frühjahr hatte ich die Aufnahmeprüfung an der HdK bestanden und war zum Studienbeginn mit Sack und Pack nach Berlin gezogen.
September 1977. In der Hochschule der Künste, im Konzertsaal, spielte Iggy Pop – das war mir wichtig! Er war ein Freund von David Bowie (wie wenig ich davon wusste, dass die Beiden kurz zuvor in Berlin gelebt hatten, wurde mir erst in diesem Jahr, 2014, in der grossen Bowie-Ausstellung bewusst). Ich bin allein zum Konzert gegangen, kannte ja noch Keinen in der großen Stadt, die ja noch eine halbe Stadt war und doch die größte Westdeutschlands, strictly West-Berlin.
Meine erste eigene Wohnung war eine recht teure möblierte Ein-Zimmer-Butze mit Aussenklo und ohne Bad in Neukölln (U-Bahnhof Grenzallee). Das war damals verbreitet in West-Berlin. Ich hatte mich bald daran gewöhnt ins Stadtbad zu gehen, um in einer der Kabinen ein Wannenbad zu nehmen. War auch gar nicht teuer.
Ja, ich war froh, von meiner Familie weg zu sein. “Das Dasein ist okay, aber Wegsein ist okayer!”, singt Funny van Dannen heute in mein Ohr. Die Familie hatte sich bald nach meinem Weggang aufgelöst (hinterrücks).
Bei mir in Berlin war Ausgehen angesagt, das war ja in Bad Gandersheim so gut wie unmöglich gewesen. Ich liess mich hierhin und dorthin treiben, was die Stadtmagazine eben so ankündigten (die taz war noch nicht gegründet, das zitty gerade erst) – ein Landei von 19 Jahren, auf der Suche nach dem Glück – und lernte viele seltsame Menschen kennen. Heute staune ich, dass mir trotz meiner grenzenlosen Naivität und Unerfahrenheit nicht mehr passiert ist als dieser Typ, den ich eigentlich meinen ersten Freund nennen müsste, wenn es nicht so peinlich wäre. Er hieß Harald und war heroin-abhängig, was mich als Fan von “The Velvet Underground” wahrscheinlich eher neugierig als vorsichtig machte, hatte ich doch bisher nur in Songtexten von dieser Droge gehört. Und das war Kunst, oder? Meine Drogen waren (und sind) Kaffee und Zigaretten. Selbst vom Alkohol wurde mir eher noch übel. Dieser Typ also hatte wunderbare lange blonde Locken und einen niedlichen süddeutschen Akzent. Die Hippiediskotheken, in die er mich ausführte, waren nicht ganz mein Geschmack. Ich hatte schon im Radio Punkmusik gehört (Niedersachsen war Einzugsgebiet vom BFBS, British Forces Broadcasting Service, wo auch John Peel sendete).
Eine neue Bekanntschaft empfand mein geringschätziges Naserümpfen über die üblichen Kneipen als Herausforderung und zeigte mir den neuesten Schuppen am Lehniner Platz: das Punk House. Von diesem Tag an war ich dort Stammgast, fuhr jeden Abend (das Nachtleben begann damals noch vor Mitternacht) mit dem 29er Bus vom Hermannplatz den Kudamm rauf. Ich hatte meine neue Heimat und viele Freunde gefunden, die zusammen mit mir das Punk-Sein in Deutschland gerade erst entwickelten. So kam es mir vor. Das war mein Ding. “Don’t know what I want but I know how to get it”. Jeder konnte so sein wie er wollte. Keine Vorschriften, keine Vorurteile. Nur Hippie durfte man nicht sein. Klar, dass ich mich von Harald trennen musste. Zum Abschied klaute er mir die paar Wertgegenstände, die mein möbliertes Zimmer hergab. Schmerzlich vermisste ich nur die Spiegelreflexkamera. Ich hatte meine erste Großstadtlektion gelernt, seitdem war ich Heroin-Usern gegenüber misstrauisch. Eine neue Kamera sollte ich erst drei Jahre später wieder bekommen, als mein irischer Freund mir eine aus einem Fotogeschäft klaute.

Aber das alles war jetzt nicht wichtig. Genauso wenig wie mein Studium. Das Nachtleben hatte mich voll im Griff und es war absolut erfüllend. “The Talking Heads” und viele andere Bands spielten live im Punk House, wo die Bühne nur ein abgeteiltes Stück Tanzfläche war, Auge in Auge mit den Fans, manche Musiker blieben hinterher noch ein Weilchen da. Wildes Pogo tanzen, sich vor Begeisterung gegenseitig mit Bier überschütten und ab und zu am Flipper austoben, solche Sachen waren jetzt wichtig. Ich lernte dort Nina Hagen kennen und schüttelte Rio Reiser die Hand.
Wie lange gab es das Punk House? Ich weiss es nicht. [Wolfgang Müller in „Subkultur Westberlin 1979-1989“ erzählt davon: „Im Sommer 1977 eröffnet das Funkhouse am Kurfürstendamm. Westberlin – Funky Town? Ein kapitaler Flop. Das Lokal läuft schlecht. Der Inhaber erkennt die Zeichen der Zeit. Eine kleine Buchstabenauswechslung hat große Folgen: Aus dem Funkhouse wird das Punkhouse. Und dieses Punkhouse entwickelt sich nun zum ersten Treffpunkt einer gerade erst im Entstehen begriffenen Westberliner Punkszene.“ ] Wenn ich die Vielfalt der Erlebnisse und der Konzerte dort addiere, komme ich auf gefühlte zehn Jahre. Es war aber wohl nur etwas mehr als ein Jahr.
Das Silvester zum Jahr 1978 erlebte ich schon mit meiner ersten Band, “DinA4”, die Mädchenband ohne Auftritte, aber mit Proberaum, den uns Blixa Bargeld in einem Keller in der Sponholzstrasse, Friedenau, besorgt hatte. Wir hatten uns im Punk House an der Theke kennengelernt und zusammengetan, Birgit, Barbara, Gudrun und ich. Wir entschieden uns für unsere Instrumente nach Gutdünken und Laune, denn Können war kein Kriterium. Silvester feierten wir in Gudruns Schöneberger Wohnung mit vielen Freunden und einem genialen Buffet voller Speisen, die mit Lebensmittelfarbe ihren ursprünglichen Charakter verlieren sollten: grüne Buletten, blauer Vanillepudding, sowas alles. Dazu mein erster LSD-Trip, eher unspektakulär.
Für mich war und ist Silvester allein schon ein Trip und dieses Feuerwerk über dem Wartburgplatz war einfach großartig. Ein paar Hippies waren auch da (aus Flensburg und Köln oder so), sie waren Musiker und hatten uns damit Einiges voraus. Sie waren okay, obwohl wir uns als Punks gern von den Hippies abgrenzten. Sie verhalfen uns später, als “Din A Testbild”, immerhin zum ersten richtigen Auftritt: 13. August 1978, Mauergeburtstag. Süße sechzehn Jahre Mauer wurden mit einer Torte gefeiert, die die
Berliner Punkband “PVC” von der Bühne herunter verteilte. Lecker! Ich glaube, es war schon eine gewisse Dankbarkeit für diesen Schutzwall vorhanden, der uns das besondere, zulagengeförderte, wehrdienstbefreite, West-Berliner Punkleben ermöglichte.
Beim Mauerfestival 1978 lernten wir die Düsseldorfer/Solinger Szene kennen. Musiker übernachteten bei uns und diese neuen Verbindungen brachten schöne Transitreisen mit sich. Wir spielten und tanzten im Ratinger Hof und in Hamburg. Ich erinnere mich heute nicht gut an die Einzelheiten. Liebesdinge spielten eine Rolle, Drogen natürlich und das, was wir definitiv nicht Rock’n’Roll nannten.
Zu der Zeit war ich bereits länger beim Plattenladen Zensor quasi “angestellt” um die Buchhaltung zu machen. Das brachte es mit sich, dass ich in Berlin alle Konzerte, die mich irgendwie interessierten, umsonst besuchen konnte. Ich bin gerade dabei eine Liste zu erstellen und die Länge, die Menge haut mich selbst um. Da wundert es mich nicht mehr, dass ich bald mein Studium geschmisssen habe. Das Leben war doch zu schön. Ich wollte es mir nicht von obskuren Aufgaben verderben lassen, die keinen Spaß machten und deren Sinn ich nicht erkennen konnte. Inzwischen wohnte ich auch in der Wartburgstrasse (Schöneberg), Parterre. Die Küche war schwarz lackiert, das Schlafzimmer bonbonfarben und das Wohnzimmer grün und blau, wie ich es heute noch schön finde. Der Vermieter regte sich fürchterlich auf und schrieb Briefe an meine Eltern und meine Hochschule. Das amüsierte mich. Es gab ein Klo in der Wohnung! Zum Baden ins Stadtbad gehen war kein Problem. Ein Problem war der Kohleofen, der sich meinen Heizkünsten fast immer verweigerte. Als ich, zu Silvester 1978/79, vom Weihnachtsbesuch bei der Familie in Westdeutschland zurückkam, hatte ich Glatteis im Flur. Es war der legendäre Schneewinter, (in Schneewehen steckengebliebene Züge, ausgefallene Heizung, Fahrgäste, die miteinander die letzten Rotweinreserven teilten). Ich kroch mit dicken Wollpullovern unter die Bettdecke. Die Silvesterparty im Übungsraum konnte ich eh nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag erfuhr ich, wer alles in welche Ecke gekotzt hatte.
Der Zensor war ganz in der Nähe, Belziger Str. 23. Burkhardt freute sich, dass ich mich mit seiner elenden Zettelwirtschaft und den Anforderungen des Steuerberaters beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und mochte es, zwischen den Schallplatten (hatte doch selbst schon eine ansehnliche Sammlung zu Hause in den Obstkisten) und ihren Liebhabern zu arbeiten. Die vorderen Ladenräume gehörten dem Blue Moon, einem Rockabilly-Klamottenladen.
– wird fortgesetzt –
*”Du bist verrückt
Mein Kind
Du musst nach Berlin!
Wo die Verrückten sind
Da gehörst du hin!
Du bist verrückt
Mein Kind
Du musst nach Plötzensee.
Wo die Verrückten sind
Am grünen Strand der Spree!”
Berliner Volkslied. Die Melodie ist ein Marsch aus der selten gespielten und ersten abendfüllenden Operette “Fatinitza” (1876) von Franz von Suppé. Der Marsch ist im Libretto nicht textiert, die Worte hat der Berliner Volksmund hinzugefügt.
Die Zeichnung “Obey/Subvert” von Rainer Jacob zeigt den “Zensor” und seine “Buchhalterin” Cordula, rechts in der Subvert-Ecke. Sie ist als Illustration für das Kapitel “Beim Zensor hinter dem Blauen Mond”, aus dem Roman “Helden ’81” von Marcus Kluge, entstanden.
Berlinische Räume – „Schöneberg Revisited“ / Eine Spurensuche

Café Mitropa
Metropol
Vinylkultstätte

Das ehemalige Café Central (Foto oben: Knut Sehrgut) und Café Swing ist heute eine Apotheke und sieht ziemlich trist aus.

22.9. 1981: “In der Nähe vom Café Berio hatte Getränke Hoffmann eine Filiale, die Schaufensterscheibe war bis auf wenige kleine Splitter, die noch im Rahmen steckten, am Boden verteilt und ein ständiger Strom von plündernden Menschen passierte das nun offene Schaufenster. Ich blieb fasziniert stehen und beobachtete das Geschehen. Obwohl ich nicht vorhatte zu klauen, betrat ich den Laden, nur um zu wissen, wie sich das anfühlte.” http://wp.me/p3UMZB-1ii
Café Berio
Slumberland
Winterfeldtmarkt
Rani
1983 kamen wir auf die Idee, jeden Dienstag im Mitropa Karten zu spielen. Das Spiel hieß Binokel und wir wurden ziemlich schief angeguckt. Gesellschaftsspiele waren sowas von uncool und dann auch noch Karten! Dazu tranken wir Weizenbier, was auch verpönt war. Heute ist “kiffen” untersagt.
Unten: Mitropa-Anzeige aus Assasin, 1983.
Deko Behrendt
Bowie-Haus
Stadtbad
Als in der Nacht zum 5. April 1986 im La Belle in der Hauptstraße 78 eine Bombe explodierte und drei Menschen tötete, schlief ich 500 Meter weiter in meiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Rheinstraße 14. Obwohl man als Berliner immer einer theoretischen Gefahr ausgesetzt war, ist der Terror selten so nahe gekommen. Die Visitenkarte drückte mir, Wochen vorher, eine hübsche junge Dame vor dem Forum Steglitz in die Hand.
Von unserem alten Domizil (oben) mit dem idyllischen Hof hinter der Leiserfiliale, Rheinstraße 14, ist nichts mehr zu finden. Nur ein seelenloser Neubau steht an seiner Stelle.
Von 1977 bis 1986 wohnte oder arbeitete ich dort. Anfang der 80er zog Herbert ein und das Gebäude wurde Redaktionssitz des Assasin. Am 10. Juli 1986 feierten wir noch meine Hochzeit auf dem Hof, wenig später wurde alles abgerissen.
So begann es: – Der Laden, in dem ich jobbte war neben einer Leiser-Schuh-Filiale und das ganze Haus gehörte Leiser. Irgendwann als ich Müll rausbrachte, fiel mir auf, dass es einen Seitenflügel gab, in dem drei Einzimmer-Wohnungen untergebracht waren. Der Seitenflügel machte einen irgendwie prekären Eindruck, man hatte ihn nachträglich an die Brandmauer geklatscht, um etwas billigen Wohnraum zu schaffen, wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts. Ich guckte mir auch den Hof genauer an, um den herum Leiser seine Lagerräume hatte. Der Hof, den offensichtlich niemand nutzte, war etwas 6 mal 30 Meter groß, den Abschluss bildete eine Terrasse, die von einem Mäuerchen zum Nebengrundstück begrenzt wurde. Eine Kastanie spendete Schatten gab dem Hof einen grünen Tupfer. Im Sommer könnte man hier bestimmt schöne Wochenenden verbringen.

Mir war klar, das die Wohnungen keinerlei Komfort boten, vielleicht war es sogar das Prekäre, das mir zusagte, mir förmlich zuflüsterte, hier wäre ein absolut passender Ort zum Leben für mich. Innerhalb von 48 Stunden mietete ich eine der Wohnungen, meine Chefin legte ein gutes Wort für mich ein, und ich zog mit meinen wenigen Sachen von der Knesebeckstraße in die Rheinstraße um. Am Anfang zahlte ich für 28qm weniger als 40 D-Mark Miete. Es war geradezu eine Einladung mich kreativ auszutoben, ohne auf die Lukrativität meiner Projekte zu achten. –
 Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.
Der Maler Stefan Hoenerloh beim Klettern.
Das Shizzo heute und damals. Das Foto unten stammt von dieser schönen Website: http://shizzo-berlin1980.de/
Kaisereiche.
Sparkassen-Kunst
MusicHall
“Die Goldenen Vampire” in der Hall.
Bewegungsmelder Kluge.
—
Berlinische Leben – “Grönemeyer kann nicht tanzen” / Eine Pinguin-Club-Anekdote

Herbert Grönemeyer (German musician and actor); arrival for the opening of the 59th Berlin International Film Festival. CC BY 3.0
–
Gestern wurde der deutsche Sänger und Schauspieler Herbert Grönemeyer 60. Auch wenn ich kein Fan seiner Musik bin, wünsche ich ihm alles Gute zu seinem runden Geburtstag. Dabei fällt mir eine kleine Anekdote ein, die ich vor einem Vierteljahrhundert im Schöneberger Pinguin-Club beobachtet habe. Wenn die Berliner etwas gut können, so ist es auf jeden Fall, einem Promi die “kalte Schulter zeigen”.
Für die Lesung am 28. Mai 2015 im Pinguin-Club erinnerte ich mich an diese kleine Anekdote:
Als ich 1987 den “Filmbär” machte, ein Berlinale-TV-Journal, fielen mir die Drehbücher für das “Hollywood-Friedenau-Spiel” wieder ein. Für ein Brettspiel hatte ich mit Herbert Nonsens-Kurz-Treatments erfunden, in denen wir bekannte Filme verballhornten. Aus “Über den Dächern von Nizza” wurde “Über den Löchern der Pizza”, oder aus “Dial M for Murder” wurde “Dial M for Mini-Pizza”. Es war zwar zu aufwändig, die Scripts tatsächlich zu verfilmen, aber wir drehten eine Reihe von Kurz-Videos in denen ich die Stories vorstelle. Kulisse bildete der Pinguin-Club und der großartige Volker Hauptvogel mixte mir zu jedem Treatment einen passenden Cocktail und servierte in mit viel Applomb.


Leider habe ich nur zwei Jahre direkt um die Ecke vom Pinguin-Klub gewohnt, das war verdammt praktisch. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt und mir fällt eine kleine Anekdote ein, um das zu illustrieren.Am 18. Mai 1991 war ich dort und gegen Mitternacht kam Herbert Grönemeyer mit zwei oder drei Begleitern herein. Die Begleiter waren offensichtlich Stammgäste, der Sänger wohl nicht. Die Begleiter zertreuten sich um mit verschiedenen Gästen zu plaudern, während der Sänger etwas verloren an der Theke stehenblieb. Nach einer längeren Weile, gelang es ihm die Aufmerksamkeit des Barkeepers zu erhaschen. Er bestellte sich ein Flaschenbier, vermutlich sowas Nordisches, wie Becks oder Jever. Niemand hatte ihm gesagt, dass es Köpi vom Fass gab. Die neben ihm stehenden kümmerten sich nicht um ihn. Also stellte sich Grönemeyer, an seinem Flaschbier nuckelnd, in die Mitte des Ladens und “guckte ob jemand guckt”. Er wippte ein wenig zur Musik, drehte sich langsam um 360 Grad im Kreis, aber niemand guckte zurück. Er wurde ignoriert. Kurz vorher war er von 100000 Menschen auf einem Open-Air-Konzert bei Ahrensfelde gefeiert worden, er hält wohl immer noch irgendeinen deutschen Rekord dafür. Auf jeden Fall drehte sich niemand zu ihm um, keiner guckte und seine Versuche mit irgendjemand ins Gespräch zu kommen scheiterten kläglich. Nach 20 Minuten sah er ziemlich frustriert aus und versuchte seine Begleiter zum gehen zu bewegen. Kurz danach stürzte er hinaus und ward nicht mehr gesehen.
–
Hier findet Ihr die ganze “Hollywood-Friedenau-Geschichte”:
Familienportrait Teil 16 – “Drei Bücher über die Pflichten meines Sohnes Marcus” / Vater und ich 1954-82

44 vor Christus flieht Marcus Tullius Cicero, der berühmte Philosoph, aufs Land. Wegen seiner Kritik nach der Ermordung Caesars fürchtet er Repressalien. Er beginnt “De officiis” zu schreiben, das sind drei Bücher über die Pflichten, die er in Briefform an seinen Sohn Marcus addressiert. Marcus studiert zu dieser Zeit in Athen Philosophie. Im Gegensatz zu seinem Vater soll er nicht sehr fleißig gewesen sein, sondern das Leben genossen haben. Ciceros Ziel war es deshalb, seinem Sohn praktische Anweisungen anhand zahlreicher Beispiele zu geben und ihm seinen Hedonismus auszutreiben.
Als ich geboren werde, kann mein Vater sich nicht entscheiden, ob er mich nach sich selbst “Helmut”, oder nach seinem großen, antiken Vorbild Cicero “Marcus” nennen soll. Deshalb steht in meiner Geburtsurkunde “Helmut-Marcus”. Mein Vater schenkt mir die “Drei Bücher über die Pflichten meines Sohns Marcus” meines Namenspaten Marcus Tullius Cicero zu meinem sechsten Geburtstag. Ich erinnere mich, dass ich mich über das unnütze Geschenk geärgert habe. Trotzdem versuche ich darin zu lesen, muss aber feststellen, dass die Sprache und der Inhalt sich selbst einem sehr frühreifen Sechsjährigen nicht erschließen. Ich kann mich nicht erinnern, was genau ich dabei dachte, auf jeden Fall werfe ich das dicke Reclam-Heft in den Hausmüll. Es muss aber eine demonstrative Geste gewesen sein, denn mir war bewusst, dass meine Eltern es dort finden. Ich rechne auch mit einer “Gardinenpredigt”, doch diese bleibt aus. Lediglich ein beiläufiges, “Bücher wirft man nicht weg”, bekomme ich zu hören. Daran habe ich mich auch gehalten, bis zum Tode meines Vaters, danach verstoße ich ein zweites Mal gegen das Gebot.
Große Erwartungen
–
Vielleicht ahnt er nun, dass die hochgesteckten Ziele, die ich für ihn erreichen soll, zu anspruchsvoll sind? Schon bei der Einschulung hatte ich darauf bestanden, die erste Hälfte meines Doppelnamens zu streichen. Statt des mir peinlichen “Helmut-Marcus” beschloss ich, als “Marcus” durchs Leben zu gehen. Das ich mich gegen seinen Vornamen entschieden habe, wird ihn gewurmt haben. Er war in solchen Dingen eitel und empfindlich.
Mit Beginn der fünften Klasse soll ich aufs humanistische Gymnasium gehen und Latein als erste Fremdsprache lernen. Mein Vater besteht darauf, dass ich auf seine alte Schule gehe, das Goethe-Gymnasium, wo er sein Abi 1937 mit einem Schnitt von 1,0 abgelegt hat.
Am 1. März 1965 ist Rosenmontag, ausnahmsweise sendet das Fernsehen schon am frühen Nachmittag und überträgt die Karnevalsumzüge. Motto der Kölner ist in diesem Jahr die “Olympiade der Freude”. Karneval interessiert mich überhaupt nicht, die Live-Sendung schon. Ich zähle die Kameras und freue mich über Unschärfen und Schnittfehler. Währenddessen turne ich auf dem Sofa, rutsche ab und lande auf dem Boden. Ein heftiger Schmerz im rechten Oberarm ist die unmittelbare Folge. Eine Röntgenaufnahme zeigt einen Bruch und im Humerus etwas, das wie ein weißes Wollknäuel aussieht. Zwei Wochen später begebe ich in die Hände von Professor Maatz im Auguste-Viktoria-Krankenhaus. Er operiert die Zysten und füllt das fehlende Gewebe mit Knochensplittern vom Lamm. Den “Kieler Span” hat Maatz, der auch an der Uni-Klinik in Kiel tätig ist entwickelt. Nach zehn Tagen in der Klinik bekomme ich ein Gipshemd. Erst nach sechs Wochen endet die Tortur und der Gips kommt endlich ab. Zwischenzeitlich hat das Schuljahr im Goethe-Gymnasium begonnen. Als ich, Monate zu spät, zum Unterricht darf, habe ich die Grundlagen für Latein verpasst. Auch in Mathe und anderen Fächern ist das Versäumte kaum nachzuholen. Meine Eltern sind der Meinung, mit meiner “großen” Intelligenz müsse ich das schaffen. Natürlich bestehe ich das Probehalbjahr nicht, das Versagen fühlt sich schmerzhaft an. Mein Vater unterstellt mir Boykott. Sein ohnehin nicht sehr herzlicher Umgang mit mir kühlt sich weiter ab, auch ich gehe auf Abstand zu ihm.
Meine Kindheit ist in einigen hundert Farb- und schwarz/weiß-Aufnahmen festgehalten. Als ich Fotos suche, die mich gemeinsam mit meinem Vater zeigen, werde ich lange nicht fündig. Zwei gefundene Bilder zeigen mich als Vorschulkind, ein einziges später. Helmut mustert mich ernst, während ich wohl Faxen mache. Schließlich ist Sylvester. Dabei hatte ich als Kind viel Kontakt mit meinem Vater, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, dass er mit mir “kindgerecht” gespielt hat oder mit mir herumgetollt ist. Er tat, was er ohnehin gern tat, oder was er tun musste und ich durfte daran teilhaben. Er spielte sehr gern Karten und so brachte er mir Canasta und Rommé bei. Im Gegensatz zu Schach machte mir das auch Spaß, weil ich nicht jedes Mal verlor. Bei Schach unterlag ich grundsätzlich und zwar nach kürzester Zeit. Nie kam es meinem Vater in den Sinn, mir vielleicht einen kleinen Vorsprung einzuräumen oder mich gar zur Motivation einmal gewinnen zu lassen. Seitdem habe ich eine Abneigung gegen das Schachspiel.
Helmut mustert mich ernst
–
Während meine Mutter tagsüber in ihrem Buch und Phonoklub wirkte, hatte mein Vater meist keine Arbeitsstelle. Er arbeitete an seiner Dissertation, gab Schauspielunterricht und er fuhr mit dem Auto durch Berlin um allerlei Einkäufe zu machen, abends war er Dozent in der Volkshochschule. Diese Einkaufstouren quer durch West-Berlin mochte ich sehr gern. Mein Vater schleppte immer drei bis vier Aktentaschen mit sich herum. Gern mochte ich die “Heftetausch-Läden”, dort bekam ich Fix & Foxi Hefte oder die Micky Maus, die ich später vorzog. Mein Vater kaufte sich Science-Fiction Schmöker und in Hinterzimmern Magazine für Freunde der weiblichen Anatomie, die damals noch verboten waren. Zwischendurch machten wir Rast in einer “Arweiterkneipe”, Papa trank ein kleines Pils und ich bekam für’n Groschen Erdnüsse aus dem Automaten auf dem Tresen. Auch am Heiligabend, während meine Mutter die Bescherung vorbereitete, ging er mit mir in die Kneipe. Wenn es dann dunkel draußen war, machten wir noch einen langen Spaziergang und zählten die Weihnachtsbäume in den Fenstern. Ich glaube, diese Erinnerung ist die schönste, die ich an ihn habe. Später habe ich mit meiner Stieftochter das Gleiche getan.
Mitte der 60er Jahre holten meinen Vater die Dämonen von zehn Jahren Krieg und Gefangenschaft in Sibirien ein. Meine Mutter stand ihm bei, bis sie selbst krank wurde.
Meine Mutter hatte eine enge Beziehung zu einem anderen Mann, doch diese war platonisch, soviel ich weiß. Als Backfisch Ende der 30er Jahre schwärmte sie für den jungen Schauspieler Wilhelm Borchert, der im Schauspielhaus mit Gründgens spielte. Nach dem Krieg wurde Borchert durch die Hauptrolle in “Die Mörder sind unter uns” zeitweise zum Filmstar. An der Seite von Hildegard Knef spielte er in dem Wolfgang Staudte-Film einen vom Krieg traumatisierten Arzt. Als mein totgeglaubter Vater überraschend 1948 aus der Gefangenschaft zurück kam, blieb Mutter lebenslang, aber auf Distanz mit Borchert befreundet. Der Schauspieler ist wohl eine Art idealisiertes alter ego meines Vaters für sie gewesen. Da sie Borchert immer wieder in Heldenrollen auf der Bühne und im Fernsehen bewundern konnte, mag viel dazu beigetragen haben, ihn zu glorifizieren. Dass Helmut ein problematischer Mensch war, schon vor dem Trauma von Krieg und Haft, wusste sie. Helmut hatte schon früh darauf hingewiesen und als Käte ihn 1948 heiratete, wusste sie dass die Ehe nicht einfach werden würde, aber meine Mutter war nicht die Frau, die sich durch Schwierigkeiten aufhalten lies. Mein Vater konnte Borchert nicht ausstehen. Er war grundlos eifersüchtig und er neidete dem “Staatsschauspieler” seinen großen Erfolg als Darsteller, der ihm selbst versagt blieb.
1966 gab meine Mutter die Hilfsversuche auf. Sie begriff, dass sie ihrem Mann nicht mehr helfen konnte und reichte die Scheidung ein. Damals gab es die einvernehmliche Scheidung noch nicht, es galt das Schuldprinzip. Es wurde eine schmutzige, lange und teure Angelegenheit, die meine Mutter zu hundert Prozent bezahlte. Danach sprachen wir zuhause nicht mehr von “Papa”, er wurde zu “Helmut”. Und “Helmut” wollte nichts mehr von mir wissen. Ich weiß nicht, was er von mir erwartet hatte, vielleicht das ich ihm folgte oder für ihn eintrat. Ich war zwölf und mir war klar, dass er keine Verantwortung für mich übernehmen konnte. Auf jeden Fall hat er sich nach der Scheidung, nie wieder um mich gekümmert. Ich bekam keine Geburtstagsgrüße oder Geschenke von ihm, keine Briefe, keine Anrufe und er hat mich nie besucht. Es war als ob ich zu existieren aufgehört hätte.
Nach ein paar Jahren rief ich ihn an, wohl auch um meiner Mutter einen Gefallen zu tun. Einige Male besuchte ich ihn, obwohl mir diese Besuche schwerfielen. Nach mir und meinem Leben fragte er nie, er klagte eigentlich immer nur sein Leid, trank dabei und wenn er einen bestimmten Pegel erreicht hatte, begann er den Monolog aus Zuckmayers “Hauptmann von Köpenick” zu rezitieren. Er tat das auf eine pathetische, weinerliche Art, ein Schauspielstil, den er eigentlich ablehnte. “…und dann stehste vor Jott dem Vater, der alles jeweckt hat, vor dem stehste denn, un der fragt dir ins Jesichte: Schuster Willem Voigt, wat haste jemacht mit dein’ Leben, un dann muß ick sagen: Fußmatte…Fußmatte, muß ick sagen, die hab ick jeflochen in Gefängnis, un da sind se alle drauf rumjetrampelt.”
Die Besuche fallen mir schwer.
–
Helmut hatte das Glück noch einmal zu heiraten. Seine Frau Eleonore stammte aus einer wohlhabenden Familie, die sich gern mit seinem Doktortitel schmückte. Eleonore mochte mich nicht, ich habe keine Ahnung wieso. Kurz vor seinem 63sten Geburtstag wollte ich meinen Vater noch einmal besuchen, aber nachdem ich über eine Stunde gewartet hatte, musste ich unverrichteter Dinge wieder gehen. Eleonore meinte, er wäre wohl auf der Arbeit aufgehalten worden. Doch ich ließ ihm “Die Sirenen des Titan”, den weisen und heiteren Science-Fiction-Roman von Kurt Vonnegut mit einer versöhnlichen Widmung, als Geschenk da. Während ich die Stufen des Hauses in der Goethestraße gegenüber der Post hinunterstieg, registrierte ich, dass mich die Wartezeit in Gegenwart der unfreundlichen Eleonore sehr viel Kraft gekostet hatte. Ich fühlte mich müde, verbraucht, am liebsten hätte ich mich auf die Stufen gesetzt. Beim Verlassen des Hauses erblickte ich weit entfernt die Silhouette meines Vaters am Steinplatz, der wie immer mehrere Aktentaschen in den Händen haltend, der Goethestraße entgegenhetzte. Wer weiß, wenn ich ein besserer Sohn, oder er ein besserer Vater gewesen wäre, vielleicht hätte ich auf ihn gewartet. Doch ich sah mich einfach nicht in der Lage, ihm ein weiteres Mal zuzusehen, wie er sich mit Wodka-Lemon betrank, um dann dem weinerlichen Vortrag der Lebensbeichte des Schusters Voigt zu lauschen. Ich beschloss es auf einen weiteren Termin zu verschieben, der hoffentlich unter besseren Sternen stehen würde.
Kurz nach seinem 63. Geburtstag, am 26. Juli 1982 starb Helmut. Eleonore lud mich und meine Mutter zum Begräbnis ein. 1982 lebte ich von der Hand in den Mund, außer abgetragenen Turnschuhe besaß ich nur ein einziges Paar elegantes Schuhwerk. Es waren violette Schlangenlederschuhe. Als Eleonore diese bemerkte, fiel sie beinahe in Ohnmacht, sie wirkte auf mich wie eine schlechte Parodie der Pawlowa, den sterbenden Schwan markierend. Und noch ein weiteres Mal empfand sie mein Verhalten als degoutant, weil ich vorzog bei meiner Mutter sitzen zu bleiben. Die ganze Feier muss ein ziemliches Desaster gewesen sein, das mein sonst so zuverlässiges Gedächtnis weitgehend gelöscht hat.
Zwei Wochen später bekam ich ein Paket von Eleonore. Es sollte mein einziges Erbe bleiben. Es enthielt einen mehrere Meter langen Schal, der dem Schal ähnelte, den Alec Guiness als Professor Marcus in “Ladykillers” trägt. Neben zwei Bänden Goethe und einem Kilo Walnüsse fand ich “Die Sirenen des Titan” und irgendetwas sagte mir, dass mein Vater mein Geschenk nie in den Händen gehalten hatte. Als letztes Erbstück hatte Eleonore eine Broschüre mit dem Titel “Über die Kriegsschuld Polens” beigefügt, was ich als besonders niederträchtig empfand. Sollte diese doch vermutlich nahelegen, Helmut wäre auf seine letzten Tage noch zum Neo-Nazi geworden. Am liebsten hätte ich die trauernde Witwe mit dem Schal erwürgt und anschließend mit den Walnüssen im Takt des “Ladykillers-Menuett” von Boccherini beworfen, die sie mir so sinnfrei beigefügt hatte. Ein zweites Mal in meinem Leben warf ich ein Buch fort, das rechtsradikale Pamphlet.
Erst nach dem Tod von Helmut, kam mir zu Bewusstsein, wie ungeheuerlich sein väterliches Gebaren eigentlich war. Als Kind und auch später habe ich es einfach so hingenommen, es hatte die normative Kraft des faktischen. Ich glaube Therapeuten sprechen da von einem Introjekt. Noch länger hat es gedauert, bis ich begriff, dass sich bei mir ein Verhaltensmuster entwickelt hatte, nachdem ich Menschen in mein Leben ließ, die mich nicht gut behandelten und die mich verließen, wenn sie meiner nicht mehr bedurften. Vielleicht gehe ich mit Helmut zu scharf ins Gericht, weil ich meine Kritik erst so spät entwickelt habe. Andererseits kann ich nichts an meinen Empfindungen ändern. Sie sind wie sie sind.
Ich weiß nicht ob es etwas geändert hätte, wenn ich mich mit meinem Vater “ausgesprochen” hätte. Ich fürchte, wir hätten aneinander vorbei geredet. Ich halte meinem Vater zugute, dass ihn zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft seelisch und körperlich beschädigt haben. Trotzdem konnte ich nie begreifen, wieso er ein derartiger Rabenvater wurde. Ich habe ihn nie gehasst, lieben konnte ich ihn aber auch nicht.
–
Bei den Theaterfotos handelt es sich um Szenen aus Inszenierungen mit Wilhelm Borchert, die meine Mutter gesammelt hat.
M.K.
Alle bisher veröffentlichten Folgen sind hier verlinkt:
Berlinische Leben – “Fünfziger Jahre Stadtbummel” / West-Berlin Fotos

“Die Tiefe der Erinnerung” / Interview mit Marcus Kluge / aus “Achte Reise zur Blechluft”

Anfang 2015 bat mich Günter Sahler um ein Interview. Für “Achte Reise zur Blechluft” befragte er mich zu meinem Blog und der Entstehung meines ersten Romans “Xanadu’73”. Hier dokumentiere ich das Gespräch für die Leserinnen und Leser meines Blogs.
Günter Sahler: In den 80er Jahren hast Du das Fanzine „Assasin“ gemacht und warst auch in der Berliner Musikszene aktiv. Als damaliger Fanzine- und Kassettenmacher dürftest Du mit Deinen Erfahrungen mit Druckereien und Selbstvertrieb beim heutigen Selfpublishing Vorteile haben. Wie siehst Du das?
Marcus Kluge: Was wir damals mit Fanzines und Kassetten probiert haben, entstand aus dem Bedürfnis sich selbst auszudrücken und eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Foto-Kopieren, drucken, Kassetten kopieren und alles in West-Berlin zu verteilen, war natürlich viel aufwändiger als heutige Distributionsformen wie das Internet. Über Berlin hinaus lief ja alles über die Post. Da ist das Internet traumhaft im Vergleich. Wichtigste Erfahrung, war: das Selbermachen und somit die Kontrolle zu behalten. Deshalb haben wir uns auch für eine kleine Berliner Druckerei entschieden und gegen eine Internet-Firma, jetzt beim ersten Buch. Vertreiben werde ich das Buch auch wieder selbst, übers Netz und hier in Berlin.
G.S.: Im Herbst 2013 hast mit dem Bloggen von Familiengeschichten angefangen. Wie hat sich das ergeben und wie bist Du dann dazu gekommen mit deinem ersten Roman zu starten?
M.K.: Nachdem ich fast 20 Jahre für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gearbeitet habe und dort die Fernsehprojekte von Laien produziert hatte, war mir meine Kreativität verloren gegangen. Selbst als ich Rentner wurde, gelang es mir nicht mehr eigene Texte zu schreiben. Es war eine handfeste Schreibblockade und ich beschloss einen Umweg zu gehen. Ich gründete die “Blinden Passagiere”, eine Selbsthilfegruppe, in der ich mit traumatisch belasteten Menschen gearbeitet habe. Ich wollte den Fokus nicht nur auf mich, sondern auch auf andere richten und das hat wohl funktioniert. Ostern 2013 bin in den Keller gegangen und kam mit einer Kiste voller Fotos, Briefe und Dokumente zurück. Ich war fasziniert von den Geschichten, die ich da fand und habe kurz danach angefangen diese aufzuschreiben. Sicher hat auch eine Rolle gespielt, dass ich im Sommer 2013 Opa wurde. Eine Freundin empfahl mir ein Blog zu machen, ab dem 13. September 2013 habe ich auf wordpress “Familienportraits” veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten wurde 12 000 mal auf Beiträge zugegriffen, eine Reichweite höher, als die Auflage von acht Assasin-Heften. Besonders die Stücke über West-Berlin kamen gut an, weshalb ich die Rubriken Berlinische Leben und Berlinische Räume eröffnet habe. Die “Leben” berichten hauptsächlich biografisch über Berliner und die “Räume” fokussieren auf Institutionen, Klubs und allgemein die Wohnsituation in der Mauerstadt. Zusätzlich habe ich auch Gastautoren gebeten über diese Themen zu schreiben, um den Blickwinkel zu erweitern. Ich möchte möglichst viel aus diesen Jahren dokumentieren, bevor die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Siegfried Cracauer hat mal über den Film gesagt, er könne ein Stück Realität für die Nachwelt retten. So etwas versuche ich mit den Mitteln des Internets, ob es mir gelingt müssen andere entscheiden.
Illu aus Blechluft
G.S.: In Geschichte „Die Legende von Xanadu“ geht es um den Heroinsüchtigen Beaky. Handlungszeitraum sind die 70er Jahre. Was wird auf dem Klappentext des Buchs stehen?
M.K.: Was auf dem Klappentext stehen wird, verrate ich noch nicht*, aber ich erzähle worum es geht. In den 70er Jahren starb ein ehemaliger Schulfreund an einer Heroinüberdosis und schon damals wollte ich darüber schreiben und habe recherchiert. Doch ich merkte, mir fehlte einfach das Handwerkszeug, das Leben von Beaky in seiner Komplexität darzustellen, ihm gerecht zu werden. Erst 35 Jahre später, Anfang 2014, schrieb ich einen kleinen Text über ein Pink Floyd Konzert 1970, bei dem Beaky vorkam und mir fiel sein kurzes, heftiges Leben wieder ein. Also beschloss ich, sein Leben in drei oder vier Kapiteln zu erzählen, an einen Roman hätte ich mich nicht herangetraut. Erst nach und nach gab ich Beaky mehr Raum und schließlich hatte ich einen kleinen Roman von ca. 140 Druckseiten fertig, zu meinem eigenen, größten Erstaunen. Ich hatte mir das nicht zugetraut. “Xanadu” ist eine Erinnerung an das West-Berlin der frühen 1970er Jahre, Liebe, Rausch und Rock’n’Roll sind die Themen. Es war mir auch wichtig, eine Art “Gegendarstellung” zu “Wir Kinder von Bahnhof Zoo” zu schreiben, ohne diese spekulative Gossenromantik des Bestsellers, der wahrscheinlich mehr Leute zum Heroin gebracht hat, als davor abgeschreckt. Mein Gegenentwurf ist Beaky, der aus einer bürgerlichen Familie kommt, der gebildet ist, Thomas Mann liest und den trotzdem eine Leere und Verlorenheit zu den Drogen treibt und dessen scheinbar dramatischer Tod in Wirklichkeit ein banaler Unfall ist.
Illu aus Blechluft
G.S.: Die Geschichten orientieren sich an der Wirklichkeit und Du schreibst über Dinge aus Deinem Erfahrungsraum. Wie sammelst Du darüber hinaus Material und wie recherchierst Du?
M.K.: Im Wesentlichen hielt ich mich an die goldene Regel und schrieb über das, was ich kenne. Ich habe ein merkwürdig ausuferndes Gedächtnis, besonders an Dinge, die keinen besonderen Nutzen oder Sinn haben, erinnere ich mich perfekt, egal wie lange das Erlebte her ist. Und wen ich mich hinsetze und zu schreiben anfange, setzt das einen zusätzlichen Prozess in Gang und die Erinnerung wird tiefer, komplexer. Mit Ausnahme der Romane schreibe ich Wirklichkeit auf, ohne sie zu verändern. Bis auf die “Erfindung”, die der Prozess der Erinnerung und des Bewusstseins, an sich eben darstellt. Erst mit dem Xanadu-Roman fließt auch fiktives ein, doch das Meiste ist nicht erfunden, ich ordne und verdichte die Dinge nur. In meinem zweiten Roman, “Ein Hügel voller Narren” ist dann auch Neu-Schöpfung eingearbeitet. Das hat sich ganz langsam, organisch entwickelt. Selbst dieses Erfundene scheint mir schon dagewesen zu sein, es fühlt sich an, als ob ich es wiederfinde und aufschreibe, das ist ziemlich merkwürdig, es hat sich ergeben, ohne das ich es forciert habe. Ich muss da an einen Begriff aus der Filmsatire “Brazil” denken, da heißt der Geheimdienst “Information Wiederbeschaffung”. So bezeichne ich den Prozess scherzhaft bei mir selbst.
Neben der Erinnerung benutze ich meine reichhaltige Bibliothek und das Internet zum recherchieren. Im Internet finde ich nicht nur Fakten, sondern auch Zeitzeugen, die ich befragen kann. Das tue ich dann in der Regel per Mail oder Telefon.
 2014, Foto: Geoff Pugh, Daily Telegraph
2014, Foto: Geoff Pugh, Daily Telegraph
G.S.: Du hast derzeit einen guten Output, fast täglich erscheinen neue Texte auf Deine Webseite marcuskluge.wordpress.com. Wie kann ich mir Deinen Arbeitsalltag als Blogger mit WordPress, Facebook und Twitter vorstellen?
M.K.: Ich versuche einmal in der Woche einen neuen, längeren Text zu veröffentlichen. Reblogs, Bilderstrecken und Gastautoren ergänzen den Output. Wenn ich das Blog nicht bespiele, nimmt das Interesse ab, dann habe ich nur noch 40-50 Aufrufe statt 100 bis 200 täglich. Wahrscheinlich fließt es bei mir auch deshalb i.M. so gut, weil ich solange einen Schreibblock hatte und in jener Zeit sind Dinge gereift.
Eine Trennung von Privatleben und Arbeit gibt es nicht mehr. Ich schreibe morgens 500 Wörter in zwei Stunden etwa, alles andere, wie recherchieren, promoten, Kontakte pflegen, empfinde ich nicht als Arbeit. Aus gesundheitlichen Gründen muss ich aufpassen, mich nicht zu überlasten. Ich mache eine Siesta mittags und oft noch eine zweite am frühen Abend. Weil die Arbeit Spaß macht, überlaste ich mich manchmal, dann muss ich Auszeiten nehmen. Ich gehe selten weg, weil mich das ziemlich anstrengt und die Technik ermöglicht, dass ich fast alles von daheim machen kann. Ich empfinde diese Möglichkeiten als Segen. Auf der anderen Seite sind mir die Gefahren durch staatliche Dienste wie die NSA, oder private wie Google, sehr bewusst. Ich fürchte die beschworene Dystopie hat bereits begonnen und wird noch sehr böse Folgen haben. Aber auf Google und Facebook zu verzichten ist unrealistisch. Ein “Grundwiderspruch” hätten die 68er gesagt. 😉
G.S.: Rainer Jacob, der auch schon das „Assasin“ gestaltet hat und dort auch Comics gezeichnet hat, zeichnet nun wieder für deine Romane „Die Legende von Xanadu“ und “Ein Hügel voller Narren” Illustrationen. Wie kann man sich die inhaltliche und technische Zusammenarbeit zwischen Dir als Autor und Webmaster und Rainer Jacob als Zeichner vorstellen? Hättest Du auch ohne die Rainer Jacob an Illustrationen zu den Geschichten gedacht?
M.K.: Rainer und ich sind seit über 40 Jahren Freunde. Obwohl, oder vielleicht auch, weil wir oft unterschiedliche Meinungen haben, respektieren wir den Anderen. Das gilt besonders für das Handwerk des Anderen, er redet mir nicht herein und ich ihm auch nicht. Natürlich gebe ich ihm Themen vor, oder sage z.B., die Figur Ghobadi stelle ich mir optisch so ähnlich vor wie Moshe Dayan. Mehr ist es nicht, welche Szene und welche anderen Figuren und Attribute er zeichnet, entscheidet er selber. Wir haben da eine fast schon intuitive Ebene des Verstehens. Manchmal zeichnet er Dinge, die im Text gar nicht vorkommen und ich greife das auf und schreibe es, oder stelle fest, dass die Sache später eine Rolle spielen wird.
Schon bevor wir, im Frühjahr 2014, unsere alte Zusammenarbeit wieder aufgenommen haben, habe ich meine Texte mit Originalfotos, Briefen, Dokumenten und anderem illustriert. Ich verfüge über ein Archiv von etwa 2000 Fotos, an denen ich die Rechte habe. Eigene, Familienfotos und Fotos, die ich in Auftrag gegeben habe aus der Assasin-Zeit. Nur zeichnen kann ich nicht. Ich hätte ohne Rainer die Romane mit Oldschool-Kollagen illustriert, hergestellt wie zu Fanzine-Zeiten, mit Cutter und Fixogum. Gibts eigentlich noch Fixogum?
Ich habe eine Lust an illustrativen Bildern, die einen in Stimmung versetzen, ohne die eigene Fantasie zu zerstören. An meinem neunten Geburtstag bekam ich “Bambi” von Felix Salten in einer wunderschönen Ausgabe geschenkt, Leinen, Fadenheftung usw. Sie hatte nur einen Fehler, sie enthielt keine Bilder. Bambi ohne Bilder? Ich habe nie Felix Salten gelesen.
Ich sehe meine Romane auch als unterhaltsame Fortsetzungsgeschichten, vielleicht eine Art Edel-Pulp, da gehört die Illustration einfach dazu.
G.S.: Du planst jetzt den Roman „Die Legende von Xanadu“ nicht nur über das Internet zu veröffentlichen, sondern auch als gedrucktes Buch. Finanzieren willst du über Crowdfunding. Wie wird das ablaufen? Wie wirst du dafür Werbung machen?
M.K.: Im Frühjahr werden wir in die Bewerbungsphase gehen, da muss man mindestens 25 Fans nachweisen, das wird kein Problem. Dann loben wir Präsente aus für alle, die uns unterstützen. Z.B. jemand der 12 Euro dazugibt bekommt ein signiertes Buch, für 20 ein schönes T-Shirt, oder auch ein Button für drei Euro. Alles natürlich im Stil der 1970er Jahre. Besonders freue ich mich auf ein “Fan-Heft”, das werden wir als Reminiszenz an das alte Assasin gestalten. In der Finanzierungsphase muss man halt viel in den sozialen Netzwerken aktiv werden und Multiplikatoren um Unterstützung bitten. Wenn das Geld zusammenkommt, wird gedruckt, die anderen Dankeschöns werden hergestellt und anschließend an die Unterstützer versandt. Den Rest der Auflage haben wir zu unserer Verfügung und können unsere Arbeit damit ein wenig bezahlt bekommen. Viele Bücher will ich auch zur Promotion verschenken. Dann könnten wir das darauf folgende Buch, also den “Narrenhügel” schon in einer größeren Auflage drucken. Mal sehen, wie’s läuft. Ich spekuliere nicht gern.
G.S.: Um ein Buch im Eigenverlag zu veröffentlichen, hat man heute zahlreiche Möglichkeiten. Seit einigen Jahren propagieren Books-on-demand-Firmen das Publizieren für jedermann. Man schickt seine Daten per Internet an diese Firmen und je nach Wunsch muss man die gedruckten Bücher selber verkaufen oder die Firma kümmert sich vollständig darum. Andererseits gibt es immer noch genügend klassische Druckereien, die die Buchherstellung übernehmen. Welche Erfahrungen hast du in dem Bereich in der letzten Zeit gemacht?
M.K.: Ich habe den Eindruck, die Net-Druckereien sind teuer, so als ob die ein Kartell bilden. Außerdem habe ich keine Kontrolle bei der Produktion, das ist mir zu anonym. Deshalb drucken wir in Berlin in einer kleinen Druckerei. Ich hätte gern ein Hardcover mit Fadenheftung gehabt, musst aber einsehen, dass das Buch damit sehr teuer geworden wäre. Inzwischen denke ich auch seriell, eine Reihe von bezahlbaren Taschenbüchern, könnte ich mir vorstellen. “Xanadu” ist ja Teil einer Trilogie, der zweite Band ist fast fertig und die Familienportraits sollten ja auch mal gedruckt werden.
Es war auch klar, das erste Buch im Selbstverlag herauszubringen. Als Anfänger hätte ich sonst Kompromisse eingehen müssen und möglicherweise nicht die Rechte behalten. Ich habe ja den Vorteil, durch eine kleine Rente unabhängig zu sein. Ich muss vom Schreiben nicht leben. Trotzdem würde ich nicht als Schreiber für die Huff oder andere Medien kostenlos arbeiten. Grundsätzlich ist Schreiben ein Beruf, der auch bezahlt werden muss.
G.S.: Ohne die Unterstützung eines Verlages, willst Du nicht nur das Buch vertreiben, sondern auch Lesungen durchführen. Wie viel Spaß hast Du am „[fast] alles selber machen“?
M.K.: Es gibt wenig, das mir keinen Spaß macht. Kalkulationen sind nicht so meins und ich bin kein großer Kontakter. Ich muss akzeptieren, dass ich nur langsam vorankomme, das ist manchmal lästig, aber die Gesundheit geht vor. Auf die Lesungen freue ich mich schon, damals als ich noch vor der Kamera stand, hat mir das Auftreten immer Freude gemacht. Das ist das Schauspielerblut meines Vaters nehme ich an. Deshalb drehe ich jetzt auch Video-Lesungen und stelle die auf youtube. Ich selbst lese lieber Bücher, aber viele Menschen mögen sich auch gern was vorlesen lassen.
Weil ich viel allein mache, versuche ich immer wieder mit Freunden und Lesern im Gespräch zu bleiben und mir auch Kritik anzuhören. Letztlich tut man was man für richtig hält, aber man sollte vermeiden abzuheben oder sich im Wolkenkuckucksheim zu isolieren.
—
2015 erschien die Printausgabe von “Xanadu ’73 – Liebe, Rausch und Rock’n’Roll in West-Berlin”, in der Edition Assassin. Das Buch hat 148 Seiten und enthält 13 Illustrationen von Rainer Jacob. Jedem Kapitel steht ein klassischer Rocksong als musikalisches Motto zur Seite. Xanadu beschreibt eine Subkultur, die sich Anfang der 70er Jahre in den Kudammnebenstraßen gebildet hatte. Bevor dieses Stück Mauerstadtgeschichte gänzlich in Vergessenheit gerät, haben wir mit einem schönen, illustrierten Buch daran erinnert.
- Das Buch kostet 13 Euro (inkl. Versand) und kann hier bestellt werden: marcusklugeberlin@yahoo.deEbenfalls bestellbar ist ein “Xanadu-Fanheft”, dass an die Assasin-Fanzines anknüpft, die ich Anfang der 80er Jahre mit Freunden herausgegeben habe. Das neue, von Rainer Jacob gestaltete Heft, vereinigt Texte, Fotos und Materialien, die das Umfeld des Xanadu-Romans beleuchten und von Kindheit und Jugend in der Mauerstadt der 60er Jahre erzählen. Außerdem enthält es Geschichten wie “A Saucerful of Löschpapier”, “Halber Mensch” und “Bela Rattay’s Dead”. Es ist im DIN A4 Format erschienen, hat 28 Seiten und ist vom Autor signiert. Den Spaß kann man für 6.20€, inkl. Porto bestellen.
*Das steht auf dem Buchrücken:
- Das kurze und heftige Leben des West-Berliners Beaky, der zehn ist als die Mauer gebaut wird und achtzehn, als er seinen ersten Trip nimmt. Er hat einen Plan, wird er funktionieren? Auf jeden Fall hat er zwei Helfer, die schöne Ungarin Susanna und den Dealer mit der Arzttasche, den alle nur den „Doktor“ nennen. Auch Professor Philippus, der Star-Therapeuten der 68er Generation wird zu seinem Unterstützer. Das Leben hat ihn aus der Bahn geworfen, doch nun steht er wieder auf und kämpft um eine bessere Zukunft. Er versucht von den Drogen loszukommen, er arbeitet beim Galeristen Puvogel, um etwas aus sich zu machen und er verliebt sich. Doch die Liebe hält nicht lange, als seine Geliebte ihn beim Heroin schnupfen erwischt, beendet sie die Beziehung. Als er auch noch Opfer der perversen Lüste seines Chefs wird, schmiedet er einen Plan, um sich an Puvogel zu rächen, seine Geliebte zurückzugewinnen und sich seinen Lebenstraum zu erfüllen. Doch dann passiert ein Unglücksfall, der wie ein Verbrechen aussieht und Beaky gerät ins Visier der Kriminalpolizei… –
Günters Website:
Das Interview und die Illus aus dem Buch erscheinen mit freundlicher Genehmigung von Günter Sahler.
Foto: Marcus Kluge mit Blechkanister, ca. 1970 (©M.K.)
Familienportrait Teil 13 – “Spaghetti um halb eins” / 1958-63

1958 hatte mein Vater Helmut seine Dissertation: “Das sprachliche Bild – Die Metapher” fertiggeschrieben. Er reichte sie an der Uni Wien ein, die er sich seltsamerweise als Alma Mater ausgesucht hatte. Vermutlich wollte er ein wenig unbeschwertes Studentenleben, fernab von Frau und Kindern, nachholen. Denn durch zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft war ihm diese Erfahrung versagt geblieben. Offiziell war der Doktorvater der Grund, der nun einmal in Wien lehrte und der die Verbindung von Philosophie, Publizistik und Theaterwissenschaft akzeptierte.
Da die Promotion sich noch 1 bis 2 Jahre hinziehen würde, suchte Papa einen Job, aber nichts allzu festes, denn später, mit dem Doktortitel würde er zu höherem streben. Sein SPD-Parteibuch brachte ihm einen Termin bei Willy Brandt ein, dem populären Regierenden Bürgermeister der Stadt. Der bot ihm an, im “Büro Willy Brandt” mitzuarbeiten, einem losen Zusammenschluss von Künstlern und Kreativen, die Public Relations für Brandt entwickeln sollten. Das Büro residierte im Haus am Lützowplatz, dass von Sozialdemokraten, Metallgewerkschaftlern und Künstlern genutzt wurde. Jule Hammer, ein umtriebiger Kulturmanager und Galerist leitete das Haus inoffiziell, ab 1963 bis 91 dann auch offiziell.
Jule Hammer kannte ich auch von SPD-Weihnachtsfeiern im Kurt-Schuhmacher-Haus im Wedding. Mein Vater musste dabei den Weihnachtsmann spielen. Er tat es ungern, weil es ihm, seiner Meinung nach, als ernsthaftem Schauspieler eigentlich nicht zuzumuten gewesen wäre. Jule Hammer verteilte die Geschenke an uns Kinder der Genossen. Hier lernte ich Hammers kleinen Sohn Thomas kennen, den ich 30 Jahre später wiedertreffen sollte.
Im Souterrain des Hauses am Lützowplatz trat Wolfgang Neuss auf, der dem Büro Willy Brandt auch nahe stand, aber nicht offiziell angehörte. Brandt war sich klar, Neuss war eine unberechenbare Größe, die seinen Ambitionen irgendwann schaden könnte. Der “Mann mit der Pauke” machte allabendlich Kabarett mit scharfen Improvisationen, die gefürchtet waren. Mein Vater nahm mich einmal mit, am Nachmittag. Neuss kiffte noch nicht, aber er nahm Tabletten, um richtig scharf zu sein und vielleicht auch um die Trauer um Wolfgang Müller zu kompensieren. Sein Partner, beruflich und privat, Wolfgang Müller, kam 1960 während der Dreharbeiten zu Das Spukschloß im Spessart bei einem Flugzeugabsturz in der Schweiz ums Leben. Wolfgang Neuss wurde mit den Worten: „Jetzt brauchen wir Sie auch nicht mehr!“ von den Dreharbeiten zu diesem Film entlassen. Die einzige Partnerin, die er danach neben sich duldete, zeigte mir mein Vater. Eine Frauenbüste, genannt “die Gips-Uschi aus der Motzstraße”.
Jule Hammer gab mit Neuss die Satirezeitung “Neuss Deutschland” heraus. Später wurde Hammers Sohn Thomas Lebensgefährte von Neuss, in dessen Haschisch- und Spät-Phase. Nach Neuss’ Tod in den 90ern, als ich für den Offenen Kanal Berlin arbeitete, traf ich Thomas wieder, der bei uns Live-Sendungen über Neuss produzierte. Thomas erinnerte an den genialen Kabarettisten, leider versuchte er auch Neuss-Texte zu interpretieren. Dazu hatte er keinerlei Talent und so wurde es eine typische OK-Sendung.
Brandt war verschlossen, er wurde mit meinem Vater und anderen Mitarbeitern nicht warm. Willy, der sich volksnah gab, war in Wirklichkeit ein einsamer Wolf. Immer blieb er unnahbar, selbst wenn man gemeinsam trinkt, was zu dieser Zeit häufig passierte. Im Rathaus und in der Partei wurde der Bürgermeister auch “Wein-Brandt” genannt.
Andere Kollegen im Büro Willy Brandt waren Günter Grass und Horst Geldmacher, genannt “Flötchen, weil der Grafiker und Musiker immer sein Instrument bei sich hatte und oft spontane Konzerte gab.
Über Geldmacher kursierte die Anekdote, wenn diesen der Weltschmerz drücke, hielte er sich wochenlang im Bett auf, ohne es zu verlassen. Auf der linken Seite des Bettes solle eine Kochplatte gestanden haben, auf der Flötchen Spaghetti kochte und daneben standen mehrere Bierkästen, die treusorgende Freunde vorbeigebracht hatten. Auf der rechten Seite landeten die ausgetrunkenen Flaschen, wieder gefüllt mit Flötchens Stoffwechselprodukten.
Das Personal-Tableau des Büros wurde durch weitere Genossen und Kunsttreibende ergänzt. Häufig wurden aus Arbeitstagen längere Zechgelage. Meist fing man unten bei Neuss an und trank sich dann durch West-Berlin. Wenn die Meute hungrig wurde, rief mein Vater meine Mutter an und flötete seinerseits: “Liebes Kätchen, magst du uns nicht was kochen?” Oft ließ sich meine Mutter darauf ein, sie fand es schon schick, prominente, wenn auch oft unkonventionelle Gäste zu bewirten.
Das Kätchen
Die Eltern
Käte kochte dann Spaghetti mit Tomatensoße und um halb eins saßen die Genossen Grass, Hammer oder Geldmacher und ihre weniger bekannten Kollegen bei uns zuhause auf dem Teppich (die Stühle reichten nicht) und aßen Nudeln.
Mein Vater blieb dem Büro Willy Brandt verbunden, versuchte sich aber immer wieder in unterschiedlichen Berufen. Als Dozent, Übersetzer, Schauspiellehrer und auch als Schauspieler. Am 21.9.1962 stand er in “Das Testament des Hundes” von Ariano Suassuna, der ersten Inszenierung der Schaubühne (damals noch am Halleschen Ufer), auf der Bühne. Ich habe ihn gesehen, ich war sieben, er kam mit Sporen an den Stiefeln, als reicher Mann lautstark auf die Szene. Ich fand ihn furchtbar peinlich, so ist das wohl in diesem Alter.
(Vater in “Das Begräbnis des Hundes” in der Schaubühne)
Die letzte Aufgabe für das Büro, war die Planung einer Gala zum 50sten Geburtstag von Brandt. Mein Vater verbreitete das Motto des Abends würde sein: “Willy Brandt, kein falscher Fuffziger mehr.” Der etwas grobe Scherz meines Erzeugers kam Brandt zu Ohren und der feuerte ihn.
Irgendwann kam auch der Kassierer nicht mehr, der die Parteibeiträge eintrieb. Ein alter Mann, der als Kommunist im KZ gewesen sein sollte. Wir Kinder hatten Angst vor ihm, er hatte etwas unheimliches. Dr. phil. Helmut Kluge war aus der SPD ausgetreten, richtig zugehörig hatte er sich ohnehin nie gefühlt.
Marcus Kluge
– wird fortgesetzt –
Alle bisher erschienen Familienportraits sind hier zu finden:
Über Horst “Flötchen” Geldmacher: https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Geldmacher
Dieses wunderbare Buch von Horst Geldmacher hat mich als 6-jähriges Kind mit Spirituals, Gospel und Blues bekanntgemacht. Die Gestaltung war stilistisch einzigartig. (Die Übersetzung von Grass war das einzig Überflüssige im Buch) Ich habe es geliebt, gelesen und danach gesungen, bis es auseinander fiel. http://www.amazon.de/Susanna-Ein…/dp/B0000BIF60
Familienportrait – „Ein anderer Kerl“ / 1954-57

Eigentlich sollte ich ein Mädchen werden. Mein Vater hatte, im Schützengraben und in Kriegsgefangenschaft, so lange in männlicher Gesellschaft verbracht, dass er sich ein Mädchen wünschte. Außerdem waren in seiner Familie seit längerem nur Jungen geboren worden. Schon Willy, der ältere Bruder von Papa wünschte sich 1930 ein Mädchen, doch es wurde ein Wolfgang daraus. Auch hegte Papa die Befürchtung, einen Sohn irgendwann in den Krieg schicken zu müssen, aus diesen Gründen sollte ich eine Tochter werden. Diesen Gefallen konnte ich ihm nicht tun, ich wurde ein Junge.
Als ich am 18. November 1954 geboren wurde, hatte ich dünne weiße Härchen, die kräftig durchblutete Kopfhaut schimmerte durch, so dass die Haare rot wirkten. Mein Vater soll mich lange angeschaut haben, die roten Haare irritierten ihn wohl, weder er noch meine Mutter war rothaarig. Er hatte schon meinen sechs Jahre älteren Bruder als eigenes Kind angenommen, obwohl Thomas einen anderen Vater hatte, so lag ein wenig Skepsis nahe. Doch schließlich sagte er zwei Sätze. Erstens: “Rotkopp, die Ecke brennt.” Und zweitens: “Wir behalten ihn trotzdem.”
Mit Etika
An Mutters Hand
Als die Wehen einsetzten war meine Mutter bei Oma in der Bundesallee 181. Oma rief meinen Vater an, sie schleppte den vorbereiteten Koffer die Treppen herunter und wartete auf Papa im Hauseingang. Damals war neben dem Haus eine Kneipe, als Papa eintraf beschloss er die anstehende Geburt müsse gefeiert werden und Oma und er marschierten in die Kneipe und tranken mit den Anwesenden eine Lokalrunde.
Als sie endlich meine Mutter abholten, kamen die Wehen bereits in beunruhigend kurzen Abständen. Als sie das Gertrauden-Krankenhaus erreichten, war die Fruchtblase geplatzt und meine Mutter brüllte aus Schmerz und aus Ärger. Kaum dass sie im Kreissaal ankam, erblickte ich das Licht der Welt und brüllte ebenfalls, auch ich hatte mich über die Verzögerung geärgert. Möglicherweise ist das der Grund, wieso ich Kneipen bis heute hasse. Cafés, Clubs oder Restaurants mag ich, doch Kneipen habe ich immer nur im Notfall betreten.
Esso-Tankstelle Rankestraße
Damals wohnten wir in einer 7-Zimmer-Altbauwohnung am Hohenzollerndamm. Meine Mutter verkaufte Bücher und Schallplatten an die Mitglieder ihres Klubs, mein Vater machte Außendienst und warb neue Kunden. Als das Geschäft etabliert war, überließ er meiner Mutter den Buch- und Phonoklub und kümmerte sich mehr um seine eigenen Ambitionen. Er gab Schauspielunterricht und arbeitete an seiner Dissertation über Metaphern auf Rednertribüne und Schauspielbühne.
Also beschloss man, eine Nanny für mich anzustellen. Sie hieß Erika und wir hatten bald ein inniges Verhältnis. Erika trug mich den ganzen Tag auf ihrem Arm herum, sogar wenn sie morgens die Öfen in allen Zimmern anheizte. Nachts schlief sie mit mir in einem Bett, unser Verhältnis konnte kaum enger sein.
Da sie meistens arbeitete, spielte meine Mutternur nur abends und am Wochenende mit mir, ich mochte sie gern, aber Erika stand mir näher. So war mein erstes gesprochenes Wort auch nicht Mama oder Papa, sondern Etika, das R gelang mir noch nicht. In meinem dritten Lebensjahr wurde es meiner Mutter zuviel mit dem engen Verhältnis zwischen Erika und mir und sie beschloss Maßnahmen, um meine uneingeschränkte Liebe zurückzuerobern.
Sie führte lange Gespräche mit Erika und weckte in dieser das Interesse, über einen Ehemann und eigene Kinder nachzudenken. Außerdem kaufte sie ihr neue damenhafte Kleider und begann Erikas Umgangsformen zu verbessern.
Einen potentiellen Gatten für Erika zu finden, war allerdings ein großes Problem. In Deutschland gab es ja, durch den ein Jahrzehnt zurückliegenden Krieg, einen Frauenüberschuss.
Meine Mutter durchforstete Zeitungen und Zeitschriften, alle Druckerzeugnisse, in denen man Anzeigen von heiratswilligen Herren finden konnte. Schließlich stieß sie auf ein seriöses Inserat eines deutschen Auswanderers in Kanada. Der studierte Volkswirt hatte sich ein kleines Unternehmen aufgebaut und suchte nun eine kultivierte Gattin, die ihm die langen Abende in der kanadischen Wildnis verkürzen sollte.
Erika war eine herzensgute junge Frau, aber Bildung hatte sie kaum, sie sprach Dialekt und hatte nur acht Jahre Schule genossen. Tatsächlich ähnelte sie Eliza Doolittle, der Blumenverkäuferin in “My Fair Lady”. Das Musical gab es zwar noch nicht, aber meine Eltern kannten die Vorlage, “Pygmalion” von George Bernard Shaw und ich bin überzeugt, meine Mutter hat sich in der Rolle des Professor Higgins gut gefallen. So wie Henry Higgins im Schauspiel, formte meine Mutter aus dem einfachen Mädchen vom Lande eine feine Dame, die einen standesgemäßen Gatten sucht.
Mein Vater tat ein übriges und übernahm den Sprachunterricht, um ihr makelloses Hochdeutsch beizubringen. Dazu wurde das geheimnisvolle Magnetophon-Gerät benutzt, das mein Papa eigens für seine Schauspielschüler angeschafft hatte. Eines Tages muss mein Vater dann: “Ich glaub jetzt hat sie’s!” gerufen haben und Erika konnte akzentfrei, “es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen”, sprechen.
Aber mündliches Deutsch war nicht die einzige zu bewältigende Disziplin, auch Briefe mussten geschrieben werden. Gefühlvolle, charmante Liebesbriefe, die das Feuer der Zuneigung beim fernen Galan entfachen sollten. Was soll ich sagen: Meine Mutter hat sie auf der Schreibmaschine entworfen und Erika schrieb sie mit ihrer etwas wackligen Jungmädchen-Handschrift ab. Dazu schickte Erika Bilder von sich in eleganten Kleidern und langen Perlenketten. Der Gatte in spe war begeistert und nach wenigen Monaten kündigte er seinen Besuch in Berlin an.

Noch ahne ich nur, dass der Herr aus Kanada (re.) mir Erika wegnehmen wird.
Die jungen Brieffreunde verstanden sich auch persönlich ausgezeichnet und es kam die erste Nacht, in der Erika nicht das Bett mit mir teilte. Instinktiv wusste ich, dass Erika dabei war, mich für einen anderen Kerl zu verlassen. Ich schrie die halbe Nacht und war nicht bereit, mich in mein Schicksal zu fügen. Aber es half nichts, schließlich wurde Verlobung gefeiert. Ich würdigte meinen Nebenbuhler keines Blickes und auch zu Erika war ich nur noch kratzbürstig. Am nächsten Tag brachten wir die beiden zum Flughafen Tempelhof. Meine Eltern kauften mir haufenweise Spielzeug, meine Lieblingsgerichte wurden gekocht und ich durfte bei ihnen schlafen. Trotzdem dauerte es Monate bis ich über den Verlust hinaus war, manchmal glaube ich, dass ich ihn bis heute nicht ganz verwunden habe. Der Kontakt zwischen uns und “Etika” brach ab, sie hatte wohl Angst, Erikas Ehemann könnte doch noch herausbekommen, dass Erika nicht ganz ehrlich zu ihm war.
Im Jahre 2013 begann ich die Geschichte meiner Familie aufzuschreiben, dabei fielen mir zwei Briefe meiner in Kanada verschollenen Nanny in die Hände. Ich überlegte schon länger, ob sie noch lebt und wie es ihr ergangen war? Ich erfuhr, Erika lebte in Calgary und hatte eine Tochter namens Marion. Tatsächlich habe ich eine Marion S. aus Calgary bei Facebook gefunden und an sie geschrieben. Marion hat 1975 ihre Schule abgeschlossen, das käme hin. Sogar die Adresse war nicht weit von der entfernt, die Erika 1958 angeben hatte. Trotzdem ich mehrfach an sie und ihren ebenfalls bei Facebook eingetragenen Sohn schrieb, bekam ich nie eine Antwort, wieso auch immer. Das einzige, was ich noch in Erfahrung bringen konnte war, dass eine Erika S. 2007 in Calgary gestorben ist.
Marcus Kluge
Berlinische Räume – „Eine Insel gegen den Zeitgeist“ / SO 36, 80er Jahre, Kneipennächte / von Cornelia Grosch

Ewig schmierig und schmuddelig, so war unser Schaufenster, obwohl wir es oft putzen ließen. Aber das Nikotin und die Ausdünstungen der Gäste hinterließen schnell wieder neue Spuren. Draußen war es – in meiner Erinnerung – immer dunkel. Drinnen auch, die Wände wurden nikotingelb, dann nikotinbraun. Die Beleuchtung war schummerig, die Einrichtung eher altmodisch. Das war unsere kleine Insel gegen den Zeitgeist.
In Großbritannien begannen die 80er Jahre schon 1979. Margaret Thatcher wurde Premierministerin und krempelte das Land mehr um, als irgendjemand sonst seit Menschengedenken. Die „Eiserne Lady“ legte sich mit Gewerkschaften und den staatlichen Unternehmen an und privatisierte alles, was nicht niet- und nagelfest war. Außenpolitisch lag sie auf einer Linie mit den USA.
1981 war dort Ronald Reagan Präsident geworden und damit begannen sie westweltweit, die 80er Jahre. Sie sollten anders enden, als sich alle Hauptakteure, aber auch wir, das Volk, vorstellen konnten. Zunächst hieß es die Gesellschaft optimieren, den Kommunismus bekämpfen, aufrüsten. Die Welt erhielt einen ungeheuren Modernisierungsschub, der auch teilweise überfällig war, der aber einher ging mit Brutalität und Kälte.
Gerade noch glaubten wir, die Irrwege der Siebzigerjahre überwunden zu haben mit ihren linksradikalen, aber in Wirklichkeit totalitären Gruppen. Meinhof, Ensslin und Baader waren tot, zusammen mit ihren Opfern, das war auch weitgehend als Irrweg erkannt, wenn auch noch nicht in der vollen Tragweite.
Ich hatte endlich erkannt, wo ich hingehörte: in die linke undogmatische Alternativ-Szene bzw. „Scene“. Deswegen hatte ich das gutbürgerliche Charlottenburg und eine ehe-artige Beziehung hinter mir gelassen und war nach SO 36 gezogen. Hatte ein Haus mit besetzt, in der BI SO 36 mitgearbeitet und abends oft die Zeitschrift der BI in den Kneipen verkauft.
Die Kneipen waren faszinierend, denn ich war ja immer noch auf der Suche nach dem Traumprinzen. Dort saßen sie. Und da ich selber schüchtern war, hatte ich mich längst an den Alkohol als kommunikationsfördernde Droge gewöhnt. Ich wollte dazugehören, zu dieser schillernden Scene, dem Jodelkeller, dem Elefanten, der Roten Harfe, dem Slainte. Nachdem ich bei einer Jodelkeller-Razzia einen Bullenknüppel abbekam, war ich „drin“. In der Kreuzberger Kneipenscene grassierte damals eine irre Angst vor Spitzeln. Wer aber mit Kopfverletzungen und blauen Augen einen Tag später im Jodelkeller auftauchte, konnte kein Spitzel sein. So einfach war das.
Anfang der Achtziger war ich also längst in diesen Kreisen bekannt, hatte einen der wildesten Trunkenbolde der Scene kennengelernt und bekam dieses Kneipenleben immer weniger mit meinem restlichen Leben in Einklang. Nachdem ich 1982 endlich mal einen tollen Architektenjob hatte und ahnte, dass sowas nie wieder kommt, beschloss ich daher, nun etwas ganz anderes zu machen.
Mit meinem Trunkenbold war ich nach Gomera ausgewandert und wieder zurückgekehrt, weil es da nicht so lief, wie wir dachten. Als Alternative hatten wir uns aber auf Gomera überlegt, dass wir in Kreuzberg eine Kneipe aufmachen wollten, natürlich nur in „unserem“ Kiez, rund um die Oranienstraße.
Wir waren pünktlich zum 1. Mai 1983 wieder in Kreuzberg, feierten auf dem Lausitzer Platz und verkündeten unsere Idee weiträumig. Die Zeit war günstig, weil der Jodelkeller wegen Sanierung dichtgemacht hatte und die Stammgäste heimatlos waren.
Ein Lokal in der Oranienstraße war auch bald gefunden, Vorbesitzer Türke; um den Mietvertrag abschließen zu können, mussten wir aber alle Beziehungen spielen lassen. Werner Orlowsky, der damalige Baustadtrat von Kreuzberg, musste für uns ein gutes Wort einlegen, dann klappte es. Wir renovierten mit Hilfe unserer späteren Gäste, von denen viele Handwerker waren. Am 11. November 1983 eröffneten wir unsere Kneipe. Sie war von Anfang an voll. Die heimatlosen Jodelkellergäste waren da. Außerdem, das war ein offenes Geheimnis, kamen alle, um zu gucken, ob wir das packten, eine Kneipe zu führen. Keiner traute uns beiden das zu, wir kannten beide den Kneipenbetrieb nur von vor dem Tresen. Ich als Konzessionsträgerin musste eine halben Tag zur Industrie- und Handelskammer, wo Dias gezeigt wurden, was man in einer Kneipe alles nicht machen durfte. Besonders erinnere ich mich noch daran, dass man Gummistiefel nicht auf dem Herd trocknen sollte. Das war meine komplette Ausbildung!
Rätselhafterweise klappte es aber ganz gut, obwohl ich lange, auch danach noch, Alpträume hatte: lauter fremde Menschen kamen in die Kneipe, bestellten alle etwas und ich fand keine Zettel, um die Bestellungen aufzuschreiben.
Mit der Zeit entwickelte sich zwischen meinem Partner und mir eine Art Arbeitsteilung: à la Belle et la Bête. Schön war ich zwar nicht, aber ich war die Nette. Auch hinter dem Tresen war mein Harmoniebedürfnis groß und ich wollte, dass die Gäste sich wohlfühlten. Mein Partner dagegen hatte den Hang zu Ausrastern. Es hatte hohen Unterhaltungswert, ihm bei so etwas zuzusehen, wenn man nicht selber Grund des Ausrasters war. Er erteilte auch gerne Hausverbote. Ich wiederum sorgte dann am nächsten Tag dafür, dass die Wogen wieder geglättet wurden. Ob unsere Gäste uns für bescheuert hielten, weiß ich nicht, nehme es aber an. Auf alle Fälle sorgten wir beide dafür, dass es bei uns nicht langweilig wurde.
Diese Kneipe war leider kein typisches Ecklokal, sondern ein in Berlin genauso oft vertretener Typ: der Schlauch. Ganz vorne das Schaufenster mit unserem schönen alten Stehtisch, an einer Seite der Tresen, auf der anderen Tische und Stühle. Hinten das „Spielzimmer“ mit Kicker, Flipper und Zigarettenautomaten, dahinter die Toiletten. Im Keller Kühlraum für Bier und Getränke, Kohlenkeller und Lagerräume.
Die Einrichtung: mit Absicht im Anti-Achtzigerjahre-Stil eingerichtet, also nicht hell und gestylt, sondern schummrig und höhlenartig. Hier wollten wir uns verkriechen und warten, dass die Achtzigerjahre vorbeigingen und wieder bessere Zeiten anbrechen würden.
Die Musik: natürlich nichts Achtzigerjahremäßiges. Mein Partner und unser Mitarbeiter, den wir vom Jodelkeller übernommen hatten, standen auf Blues und ähnliches. Johnny Winter, John Lee Hooker, aber auch David Peel oder die Edgar Broughton Band gehören zu meinen akustischen Erinnerungen. Ich spielte mehr meine eigenen Mixtapes, aufgenommen bei RIAS-Treffpunkt oder S-F-Beat, aber auch bei mir fanden sich weder Depeche Mode, Talking Heads noch die Neue Deutsche Welle.

Die Gäste: eine wilde Mischung aus allem, was da wohnte, arbeitete oder sonst irgendetwas dort zu tun hatte. Überwiegend Ex-Jodelkellergäste, aber auch Afrikaner aus dem afrikanischen Zentrum nebenan, einzelne Frauen und Kinder (nachmittags), alte Bekannte + neue Bekannte aus den Parallelwelten. Später hatten wir auch viele Punks als Stammgäste, die auch um die Ecke oder gegenüber in besetzten Häusern wohnten. 99,9% unserer Gäste waren Stammgäste, aber zum Glück kamen auch manchmal Touris rein (die je nach Ausgangslage angepöbelt oder umarmt wurden). Viele unserer Stammgäste verdienten ihr Geld als Handwerker, arbeiteten aber meistens nur so viel, um leben zu können. Dazu brauchte man nicht viel, die Mieten und das Bier bei uns waren billig. Es gab aber auch den klassischen Studenten, der Taxi fuhr, den Filmvorführer, der nach der Arbeit kam, eine Lehrerin, die oft als letzte ging, aber am nächsten Morgen wieder unterrichten musste. Nicht zu vergessen die Künstler, die auch bei uns ausstellten.
Nachdem ich meine anfängliche Unsicherheit überwunden hatte und meistens doch Zettel zum Aufschreiben der Bestellungen da waren, genoss ich den Job. Er war anstrengend, aber ich war die wichtigste Frau im Lokal. Das war toll und für mich eine ganz neue Erfahrung!
Das wichtigste an dem Job war nicht das richtige Zapfen von Bier, sondern das Schaffen von Stimmungen, die durch die Auswahl der Musik, aber auch durch meine Interaktionen mit den Gästen geschaffen werden mussten. Wenn Aggressivität in der Luft lag, legte auch ich Blues auf. Leute rauszuschmeißen war für mich ungefährlich, aber manchmal langwierig (es gab anscheinend ein Tabu, Frauen zu hauen; mir ist nie was dabei passiert). Wenn aber, was öfter vorkam, nachmittags gleich nach dem Öffnen noch nicht viel los war, dann musste ich meine lebhaftesten Mixtapes auflegen und mich um die Gäste kümmern, mich mit ihnen unterhalten, Würfel spielen oder zusehen, dass sie sich untereinander beschäftigen konnten. Jeder Stammgast musste als Persönlichkeit behandelt werden. Ich kam mir oft eher als Therapeut, Rettungssanitäter oder Frau Dr. Sommer (Beratung in allen Lebenslagen) vor. Das war eben das Plus, was die Gäste erwarteten, sonst wäre es auch in den Achtzigern billiger gewesen, sich einen Sixpack zu kaufen und zu Hause zu trinken.
Es war ein tolles Leben, ich hatte endlich einen Job, für den man nicht früh aufstehen musste (15 Uhr reichte, um das Lokal um 17 Uhr aufmachen zu können), ich verbrachte auch freiwillig meine Freizeit dort, weil die Leute so toll waren und hatte – nach der privaten Trennung von meinem Partner – freie Auswahl unter den Männern, die sich bei uns rumtrieben.
Nachdem ich aber 4 Jahre hinterm Tresen stand, wurde auch das langsam langweilig. Ich kannte meine Stammgäste in- und auswendig, trank zu viel, sah kein Tageslicht mehr und keine normalen Menschen. Wie krass das war, merkte ich eines Wintermorgens, als ich gegen 5:30 morgens nach Hause ging und mir graue, geduckte Wesen begegneten, die zur Arbeit gingen. Ich bedauerte sie, merkte aber erst später, dass ich selber ja von der Arbeit kam und eigentlich genauso bedauernswert war. Dass auch eine Arbeit, die man sich selbst ausgesucht und eingerichtet hatte, anstrengend und öde sein konnte, musste ich erst langsam erkennen.
Nachdem ich 1987 einen anderen Mann kennengelernt hatte, der nicht Stammgast bei uns war und dadurch auch wieder ein Leben neben der Kneipe hatte, kündigte ich Anfang 1988 meinen Ausstieg an, wollte allerdings erst aufhören, wenn meine Nachfolge geklärt wäre. Mein Kneipenpartner wollte das nicht wahrhaben und es passierte nichts. Zum Glück wurde ich im Frühjahr 1988 schwanger und hatte somit einen Grund aufzuhören. Einen besseren Zeitpunkt für eine Schwangerschaft konnte es nicht geben!
Epilog:
Ein neues Leben begann für mich, ich machte aber weiterhin Abrechnung, Buchführung und den Behördenkram, weil ich auch weiterhin die Konzessionsträgerin blieb. Es war also immer noch „meine“ Kneipe.
Bis zum Mauerfall lief die Kneipe mit wechselndem Personal, aber im Wesentlichen unverändert weiter, dann kam ein Jahr Pause, weil das Haus saniert wurde.
Nachdem wir Ende 1990 wieder eröffneten, hatte sich die Welt um uns herum komplett geändert. Deutschland war wiedervereint. Die Achtzigerjahre waren zwar vorbei, die Siebzigerjahre kamen aber leider auch nicht wieder. Kreuzberg wurde uninteressant, alles wandte sich den östlichen Bezirken wie Mitte und Prenzlauer Berg, später auch Friedrichshain, zu.
Die in unserer Nähe lebenden Ossis (hinter dem Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße) interessierten sich nicht für uns, es waren eben typische Hochhausbewohner und mit ein paar netten neuen Leuten aus dem Osten ließ sich nicht annähernd an die früheren Zeiten anknüpfen. Hinzukam, dass einige Stammgäste wegzogen – und was noch häufiger passierte – wegstarben. Jahrzehntelanger Alkohol- und Nikotin-Abusus forderte seinen Tribut. Der Kneipe gings schlecht.
Mein (Kneipen-)Partner führte Live-Musikabende ein, die dann auch tatsächlich für ein volles Haus sorgten, aber eben nur einmal die Woche. Zum Glück konnte das Trauerspiel dann 2000 durch Verkauf beendet werden, ohne allzu großen Verlust zu machen. Ich musste noch mal zum schönen Amtsgericht am Lietzensee, um gegen die heißgehasste GEMA zu prozessieren und unsere Schulden bei der Berufsgenossenschaft bezahlen, weil diese Verträge auf mich liefen. Dann war die Kneipe Geschichte.
C. G.
Familienportrait „No Tears” / Eine Nachtgeschichte 1989-92

Otto von Bismarck soll gesagt haben, “Es ist besser wenn das Volk nicht weiß, wie Würste gemacht werden. Das Gleiche gilt für Gesetze, die Leute schlafen besser, wenn sie über deren Herstellung nichts erfahren.” In der Greifswalder Straße 224 hat es einen Betrieb gegeben, der Würste herstellte. Und bevor dort die Därme von geschlachteten Tieren mit fragwürdigen, fleischhaltigen Massen gefüllt wurden, mussten die fragwürdigen Massen, die vorher die Därme füllten, entfernt werden. Dafür gab es dort im Keller eine “Darmwäsche”, der Name wurde beibehalten, obwohl ab 1990 in diesem Keller gänzlich andere Prozesse stattfinden sollten. Da diese für unsere Geschichte wichtig sind, werden wir darauf zurückkommen.
Kiki, ein untypischer “Ostler”
Nach dem Mauerfall habe mich ich oft mit einen entfernten Verwandten aus Cottbus getroffen, Kiki und ich wurden Freunde. Obwohl er um die 15 Jahre jünger war als ich, gerade mal 20 damals, verstanden wir uns ausgezeichnet. Er war ein sehr untypischer DDR-Bürger und ich war wohl ein untypischer West-Berliner für ihn. Ich interessierte mich nicht für Geld und Karriere, hatte kein Auto, noch nicht mal einen Führerschein. Ich war absolut nicht, was er sich unter einem Wessi vorstellte. Er hatte das Glück, als Sohn eines Chefarztes in der DDR gewisse Privilegien zu geniessen. Schon zu DDR-Zeiten trug Kiki Levis Jeans, schwarze T-Shirts und Cowboystiefel, während weniger Glückliche schon Schwierigkeiten hatten, Socken oder tragbare Unterwäsche im normalen von der Planwirtschaft versorgten Handel zu finden. Kikis Familie ging ins “Ex”, wo man mit DDR-Geld überhöhte Preise zahlte und in den Intershop, wo Ostgeld gar nicht angenommen wurde. Mikis Vater verdiente als begehrter Gynäkologe auch “Bunte”, also West-Geld. Kiki verzichtete auf den Stress zu studieren, was wohl klug war. Als Sohn eines “Intelligenzlers” hätte er es schwer gehabt und um einige Jahre “freiwilligen Dienst” in der Volksarmee wäre er nicht herum gekommen. Ohne diese war ein Studium so gut wie ausgeschlossen. Also entschloss er sich Zahntechniker zu werden, dann fiel die Mauer und verdiente mit diesem Beruf bald ganz ordentlich. In diesem Punkt waren wir unterschiedlich, für Geld hatte ich leider nie ein Händchen. Als Zahntechniker hat er auch seine Militärzeit ohne Drill überstanden. Er arbeitete beim Zahnarzt der Volksarmee als Stuhlassistenz, wenn dieser den Rekruten auf den Zahn fühlte.
Gleich nach der Währungsreform fuhr Kiki in den Westen, um sich ein Auto zu kaufen. Normalerweise schätze ich Männer mit großen Benzinkutschen nicht sonderlich, aber bei Kiki hielt ich das für eine liebenswerte Marotte, schon weil er es gehörig übertrieb mit seiner ersten Motorisierung und generell hielt ich ihm den “Nachholebedarf” zugute. Er hatte mit Hilfe von Helmut Kohl und dem Steuerzahler, wie jeder DDR Bürger sein Ostgeld in D-Mark verwandelt, das war der Grundstock von 4000.-. Dann borgte er sich noch einiges dazu und fuhr schliesslich nach Hamburg, um eine gebrauchte, dunkelgraue 420er Daimler-Limousine zu kaufen. Es war ein riesiger protziger Schlitten, den ihm ein Zuhälter für 20000.- D-Mark überließ. Soviel hatte neu allein das C-Netz-Telefon gekostet, das für Kiki in Cottbus natürlich völlig nutzlos war. Der Benzinverbrauch war etwa so hoch, wie bei einem sowjetischen Panzer älterer Bauart, aber das Fahrgefühl war hervorragend, selbst auf der Autobahn war der Motor so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören.
Ein untypischer “Westler”
Ich arbeitete seit März 88 beim Offenen Kanal Berlin und ich disponierte seitdem einen Radio- und einen Fernseh-Sender, allein und ohne einschägige Erfahrung. Der Job war schwer, vor mir hatten schon diverse Kandidaten abgewunken. Ich musste in kurzer Zeit sehr viel lernen und biss mich durch. Damals litt ich noch ziemlich unter einer Sozialphobie, das machte die Sache nicht unbedingt leichter. In meiner Freizeit suchte ich Ausgleich, ging wieder viel auf Konzerte. Ich hörte Rock, Punk auch Metal, Hauptsache ein guter Trommler war am Werk und mein Bauchgefühl stimmte. An elektronisch fabrizierte Drums konnte ich mich nie gewöhnen, auch später nicht. Natürlich ging man viel in die Ostberliner Läden, im Westen kannte man Leute und Orte meist zur Genüge und im Osten gab es noch “terra incognita”.
Das erste Mal kam Kiki Ende 1989 nach West-Berlin, um sich eine Lederjacke zu kaufen, ich ging mit ihm in den Kant-Store und er war sehr zufrieden. Wir merkten, das wir uns mochten und immer, wenn er in Berlin war, zogen wir zusammen um die Häuser. Als 1990 die Berlin Independence Days anstehen, akkreditiere ich kurzerhand Kiki und mich als Fanzine-Macher. Die B.I.D. war ein heute fast vergessenes Rock-Musik Festival und eine Konferenz, die Panels und Vorträge haben mich wenig interessiert, ich wollte in den vier Tagen möglichst viele gute Bands sehen. Es war streng genommen eine meiner kleinen Hochstapeleien, denn mein Fanzine hatte ich 1985 aus Geldmangel aufgegeben. Später als ich dann Geld verdiente, hatte ich keine Zeit mehr für eine solche Publikation. Immerhin habe ich in diesen Tagen einige Berliner als D.J.s für das Radioprogramm des Offenen Kanals angeworben. Kiki fand die Idee mit dem Festival toll und nahm sich ein paar Tage frei. Es ist das einzige Mal gewesen, dass ich eine meiner Einschleichaktionen nicht allein gemacht habe. Abends gingen wir in die Klubs und schauten uns ein halbes Dutzend Bands an. Nur wenige waren richtig gut, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch. Wenn wir angesprochen wurden, wieso wir an der BID teilnähmen, dachten wir uns spontan jedesmal eine andere, unwahrscheinliche Lügengeschichte aus. Mal kamen wir von einem finnischen Art-Pop-Label “Kixli Taxli Pickwickii”, ein anderes Mal verkörperten wir das ungarische Büro für Alkoholismus und Punkfragen. Dann schliefen wir bis mittags, gingen ins Mitropa frühstücken oder in die Thermen, das Bier ausschwitzen. Kiki war ein kongenialer Partner bei meiner Felix-Krulliade.
Zum Jahreswechsel machte Kiki bei sich in Cottbus eine Party und ich fuhr hin um mitzufeiern. Als mich Kiki vom Bahnhof abholte und wir zu seinem Daimler kamen, standen dort sieben oder acht kleine Jungs und bewunderten die Protzkutsche. Es war mit Sicherheit der erste 420er in der Lausitz. Kiki musste Fragen beantworten, es machte ihm Spaß, noch. Als ich ihn Jahre später in Dresden besuchte fuhr er am liebsten einen FIAT Cinquecento, so ändern sich die Zeiten. Wir feierten ausgiebig Sylvester, ich schlief auf dem Boden, das ich mir das antat beweist, dass ich Kiki wirklich gern mochte.
Eine gänzlich unwahrscheinliche Geschichte
Im Frühjahr 1991 besuchte mich Kiki mit seiner Protzkutsche in Berlin, wir beschlossen an diesem Sonnabend in den Knaack-Klub zu gehen. “Es ist schon merkwürdig, wen man nicht kennengelernt hätte, wenn man nicht an jenem Abend genau dorthin gegangen wäre? Das Leben wäre anders verlaufen, aber wie?” Solche Überlegungen führen mich regelmäßig zu der Feststellung, das Zufälle das Leben bestimmen und genauso oft führen sie mich zur gegenteiligen Ansicht, nämlich dass es Zufälle gar nicht nicht gibt und das Schicksal einem eigenen, ausgeklügelten Plan folge. Manchmal haben solche Zufälle lebensverändernde Wirkung. Ohne Kiki wäre ich auf jeden Fall an diesem Tag nicht in den Knaack gegangen, schon gar nicht in die sogenannte “Darmwäsche”.
Der Knaak hatte drei “floors”, aber das sagte man noch nicht, es hieß wohl drei Etagen, glaube ich. Im ersten Stock tanzte bravgekleidetes junges Volk zu Nena, den Puhdys und Chris de Burgh, im Erdgeschoss ging es ziemlich “Heavy” zu, aber im Keller, da ging wirklich der Punk ab, hatten wir zumindest gehört. Was der Name bedeutete enträtselten wir damals nicht. Der Klub in der Greifswalder Straße 224 war früher ein DDR-Jugendklub gewesen, in dem seit 1952 junge Leute dem westlichen Einfluss der Rockmusik entzogen werden sollten. 1973 wurde eine Discothek eingerichtet, die nach dem Mauerfall eigene Wege ging und sich privatisierte. Von Freier Deutscher Jugend zu Betriebs-Wirtschafts-Lehre sozusagen. Von nun an diente die “Darmwäsche” dem Tanzvergnügen und der Anbahnung zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Kellerräume waren kaum renoviert oder sonstwie aufgehübscht, es roch muffig, aber die Musik war Klasse und das Publikum angenehm. Die Musik erinnerte mich sehr an die alte Music-Hall. Der Gintonic kostete 2.50.- und es roch nach Cannabis. Es war schon weit nach Mitternacht, der D.J. spielte “No Tears” von Tuxedomoon, auch wie in der Hall, als mir eine Tänzerin auffiel. Ihre kraftvoll-grazilen, stampfenden Bewegungen zogen mich in ihren Bann, ich konnte kaum wieder wegsehen. Damals hatte ich ja noch unter ziemlich heftigen Sozialängsten zu leiden. Eine Frau ansprechen war fast unmöglich. Und bevor jetzt eine Diskrepanz zu meinen Eulenspiegeleien entsteht, muss ich darauf hinweisen, dass wenn ich eine erfundene Rolle spielte, ich von diesen Sozialphobien plötzlich und gänzlich befreit war. Umso mehr, je unwahrscheinlicher und abstruser sich diese Fiktionen gestalteten. Nur wenn es um richtige Menschen, echtes Leben und wahre Gefühle ging, fiel mit einem Mal der eiserne Vorhang von Angst und Unsicherheit herunter und machte es mir unmöglich zu sprechen und halbwegs gefasst zu agieren. Die Lichtgestalt auf der Tanzfläche mit den langen Haaren und den unwiederstehlichen Bewegungen eines bockigen Kälbchens, schnürte mir die Kehle zu. Nach einem weiteren Gintonic und einer meditativen Sammlung, ging ich aufs Ganze und schnorrte eine Zigarette von ihr. Dabei rauchte ich damals überhaupt nicht. Wir wechselten ein paar Sätze, unmöglich zu sagen, um was es ging. Der Inhalt liegt völlig im Dunkel, mir fiel auch nichts ein, um das Gespräch zu verlängern, ich hatte einen Black-Out. Nachdem wir also eine Weile still nebeneinander gestanden hatten, nickte sie mir freundlich zu und ging wieder tanzen. Ich bat Kiki und den anderen Freund, der noch dabei war, mit mir die Stätte meines Versagens zu verlassen. Wir gingen nochmal auf die anderen Floors kucken, es muss so gegen halbvier gewesen sein, dann gingen wir. Der Protzschlitten stand in einer Nebenstraße. Kiki war so gut wie nüchtern, sein Führerschein und sein Auto waren ihm so wichtig, dass er da keine Kompromisse einging und wir fuhren die Greifswalder Straße in Richtung Alexanderplatz hinunter. Dann sah ich das Böckchen von der Tanzfläche auf dem Bürgersteig mit gleichem Ziel, also westwärts stiefeln. Ich war von ihrem Gang wie hypnotisiert und Kiki war schon ein paar hundert Meter an ihr vorbei, als ich ihn stoppen ließ. Als er begriff, worum es ging, fuhr er rückwärts bis auf ihre Höhe und bremmste mit quietschenden Reifen. Die Szene sollten wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, um zu verdeutlichen, dass das was nun passierte, gänzlich unwahrscheinlich war und sozusagen aus Zeit und Raum fiel. Um vier Uhr morgens, in der Greifswalder Straße, die unter Platzängstlichen gewiss einem besonders verhehrenden Ruf hat, hält nun ein riesiger Daimler, ein Zuhälterschlitten mit drei suspekt aussehenden jungen Männern. Einer, nämlich ich, betätigt den Fensterheber um das Fenster zu senken, und spricht eine ja im Grunde genommen, völlig fremde Frau an und fragt, ob sie denn nicht zufällig Lust hätte noch ein wenig mit, in eine nicht näher bezeichnete Bar zu kommen? Es darf als unbedingt gesichert gelten, dass keine auch nur halbwegs vernünftige junge Dame, ein solches Ansinnen nicht abgelehnt hätte. Anders Sabrina, diese äußerte im Ausdruck höchst nebensächlicher Belanglosigkeit: “Wieso denn eigentlich nicht”, was man getrost unter die rhetorischen Fragen einordnen darf.
Wir fuhren mit der Protzkutsche nach Schöneberg und landeten in einer Bar nahe dem Nollendorfplatz. Es war das Sexton glaube ich. Hier verlässt mich erneut mein sonst so zuverlässiges Gedächtnis, keine Ahnung worüber wir sprachen, aber es muss ganz nett gewesen sein. Wir tranken einen Absacker, Sabrina gab mir ihre Telefonnummer und wir verabschiedeten uns.
Um nicht als bedürftig zu wirken, wartete ich bis donnerstags mit dem Anruf. Wir trafen uns dann am Sonntag im Café Central, ein Funke sprang über und binnen weniger Tage waren wir in einer Beziehung. Fast zwei Jahre war ich mit der fleißigen Medizinstudentin zusammen, dann zog ich Konsequenzen aus der Tatsache, dass es eine gewisse Asymmetrie in unserer Freundschaft gab. Sie mochte mich gern, aber ich liebte sie.
In dieser Zeit nach dem Mauerfall veränderte sich nicht nur die politische Landschaft, auch privat überdachte man vieles neu und stellte althergebrachte Ansichten auf den Prüfstand. Beispielsweise war ich, bis dahin, nie bereit gewesen, eigene Kinder in die Welt zu setzen, weil ich mich nicht reif genug dafür fühlte. Ich war zwar ohne mein biologisches Zutun zwischen 1980 und 88 Stiefvater geworden und blieb es nach der Trennung von der Mutter auch, aber das war ja nicht meine Entscheidung gewesen. Ich war wie eine Jungfrau zu meiner Tochter gekommen. Nun 1991 öffnete sich bei mir ein Zeitfenster und ich hätte mir vorstellen können mit Sabrina eine Familie zu gründen. Ich war 37 während Sabrina erst Mitte 20 war und ihr Medizinstudium war das Wichtigste in ihrem Leben, die Gründung einer Familie und eigene Kinder waren einfach noch kein Thema für sie. Das Zeitfenster schloss sich wieder, ich beendete die Beziehung vielleicht etwas voreilig, aber konsequent. Auch für Konsequenzen war es eine große Zeit. Ich weinte der Beziehung keine Tränen nach. No Tears for the Creatures of the Night. Vielleicht war das ein Fehler, doch es war keine Zeit für Tränen, damals Anfang der 90er Jahre, in der Zeit nach dem Mauerfall und der Vereinigung, von der wir damals alle nicht gedacht hätten, dass sie bis heute immer noch nicht abgeschlossen sein würde.
–
Das letzte Foto (Ingrid Johnson) zeigt den Autor 1993 im Hof vom Knaack-Club.
No Tears
No tears for the creatures of the night
No tears
No tears for the creatures of the night
No tears
My eyes are dry
Goodbye
My eyes are dry
Goodbye
I feel so hollow I just don’t understand
Nothing’s turned out like I– like I planned
My head’s exploding
My mouth is dry
I can’t help it if I’ve forgotten how to– cry
No tears for the creatures of the night
No tears
Uh oh, oh no, uh oh, oh no, uh oh, oh no
No tears for the creatures of the night
(In 1979 Tuxedomoon released the EP No Tears, with the single “No Tears”. The single is described as “one of the best electro-punk hymns of all times.)
–
Sowohl mit Kiki, als auch mit Sabrina, habe ich um die Jahrtausendwende den Kontakt verloren. Vor ein paar Wochen fand ich Sabrinas E-Mail-Adresse im Web und schrieb ihr. Sie hat doch noch ein Kind bekommen und ist inzwischen Professorin, es freut mich zu hören, dass es ihr gut geht. Kiki habe ich auf Facebook gefunden, er freut sich über meine Schriftstellerei und hat im Sommer das Crowdfunding für mein erstes Buch großzügig unterstützt. Er selbst hat in diesem Jahr geheiratet.
Marcus Kluge
– Ende –
Namen und andere Details sind teilweise verändert, um die Persönlichkeitsrechte von porträtierten Personen nicht zu verletzen.
Schnelle Schuhe – „Landei, aufgeschlagen.“ / von Cordula Lippke / aus der Reihe: Punk in West-Berlin Teil 4
Meinen kleinen Rückblick zum 2. Geburtstag des Blogs, beende ich mit einer Zeitreise ins Jahr 1977, als sich im Punk House am Lehniner Platz die West-Berliner Punkszene konstituierte. Meiner Freundin Cordula Lippke bin ich für diese unterhaltsam-authentische Zeitstudie sehr dankbar, zumal ich selbst erst später in diese Szene kam. Ich lernte Cordula beim Zensor kennen, für den sie arbeitete und dadurch quasi automatisch die West-Berliner Musiker und hier gastierende Künstler kennenlernte. Zu gern würde ich deshalb eine Fortsetzung von Cordulas Text lesen und ich weiß, dass es vielen Lesern ebenso geht. Sie wird auch kommen, die Fortsetzung, da bin ich sicher. Aber wie ich gestern feststellte, manches kann man nicht erzwingen: “You Can’t Hurry Love” und auch das Schöpferische ist eigensinnig, es kommt wenn es da ist. Aber erst einmal: Vorhang auf für einen Besuch im West-Berlin der 70er Jahre. M.K.

Für meinen Sohn, der gerade 19 ist und seine Jugend an der XBox verschwendet.
1977 kam ich nach Berlin um Kunst zu studieren, eigentlich: Visuelle Kommunikation, der eben erst eingerichtete FB 4 der Hochschule der Künste (die seit 2002 Universität der Künste heißt). Meine Eltern hatten es für mich vorbereitet. Ich war schon zur Aufnahmeprüfung nach Berlin gereist, aus Bad Gandersheim, wo ich gerade mein Abitur bestanden und bei der Zeugnisausgabefeier meinen ersten Vollrausch erlebt hatte.
Berlin war mein Sehnsuchtsort aus vielen Gründen. Auch dieses Lied, das ich aus einem alten deutschen Spielfilm kannte, schwingt da mit:
“Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin … Da
gehörst du hin”* [„Der eiserne Gustav“ 1958].
Kurz zuvor war ich noch Bowie Fan gewesen. Bowie hatte mir zuerst meine Schwester im gemeinsamen Kinderzimmer vorgespielt: “There’s a starman waiting in the sky …” Das hatten wir 1972 im Chor gesungen.
1971 besuchten wir als Familie Berlin. Wir waren mit dem Flugzeug in Tempelhof gelandet, im Zoo und in Ost-Berlin gewesen und konnten einem Selbstmörder beim Nichtspringen vom Europa-Center zuschauen.
Ich hatte die Nase voll von den irritierten Blicken der Kleinstädter und Kurgäste, wenn meine roten oder blauschwarzen Haare, meine schrille selbstgeschneiderte Kleidung (eine Hommage an meine Oma Alwine, die immer alles selbst genäht hatte), ihr Weltbild störten. Im Frühjahr hatte ich die Aufnahmeprüfung an der HdK bestanden und war zum Studienbeginn mit Sack und Pack nach Berlin gezogen.
September 1977. In der Hochschule der Künste, im Konzertsaal, spielte Iggy Pop – das war mir wichtig! Er war ein Freund von David Bowie (wie wenig ich davon wusste, dass die Beiden kurz zuvor in Berlin gelebt hatten, wurde mir erst in diesem Jahr, 2014, in der grossen Bowie-Ausstellung bewusst). Ich bin allein zum Konzert gegangen, kannte ja noch Keinen in der großen Stadt, die ja noch eine halbe Stadt war und doch die größte Westdeutschlands, strictly West-Berlin.
Meine erste eigene Wohnung war eine recht teure möblierte Ein-Zimmer-Butze mit Aussenklo und ohne Bad in Neukölln (U-Bahnhof Grenzallee). Das war damals verbreitet in West-Berlin. Ich hatte mich bald daran gewöhnt ins Stadtbad zu gehen, um in einer der Kabinen ein Wannenbad zu nehmen. War auch gar nicht teuer.
Ja, ich war froh, von meiner Familie weg zu sein. “Das Dasein ist okay, aber Wegsein ist okayer!”, singt Funny van Dannen heute in mein Ohr. Die Familie hatte sich bald nach meinem Weggang aufgelöst (hinterrücks).
Bei mir in Berlin war Ausgehen angesagt, das war ja in Bad Gandersheim so gut wie unmöglich gewesen. Ich liess mich hierhin und dorthin treiben, was die Stadtmagazine eben so ankündigten (die taz war noch nicht gegründet, das zitty gerade erst) – ein Landei von 19 Jahren, auf der Suche nach dem Glück – und lernte viele seltsame Menschen kennen. Heute staune ich, dass mir trotz meiner grenzenlosen Naivität und Unerfahrenheit nicht mehr passiert ist als dieser Typ, den ich eigentlich meinen ersten Freund nennen müsste, wenn es nicht so peinlich wäre. Er hieß Harald und war heroin-abhängig, was mich als Fan von “The Velvet Underground” wahrscheinlich eher neugierig als vorsichtig machte, hatte ich doch bisher nur in Songtexten von dieser Droge gehört. Und das war Kunst, oder? Meine Drogen waren (und sind) Kaffee und Zigaretten. Selbst vom Alkohol wurde mir eher noch übel. Dieser Typ also hatte wunderbare lange blonde Locken und einen niedlichen süddeutschen Akzent. Die Hippiediskotheken, in die er mich ausführte, waren nicht ganz mein Geschmack. Ich hatte schon im Radio Punkmusik gehört (Niedersachsen war Einzugsgebiet vom BFBS, British Forces Broadcasting Service, wo auch John Peel sendete).
Eine neue Bekanntschaft empfand mein geringschätziges Naserümpfen über die üblichen Kneipen als Herausforderung und zeigte mir den neuesten Schuppen am Lehniner Platz: das Punk House. Von diesem Tag an war ich dort Stammgast, fuhr jeden Abend (das Nachtleben begann damals noch vor Mitternacht) mit dem 29er Bus vom Hermannplatz den Kudamm rauf. Ich hatte meine neue Heimat und viele Freunde gefunden, die zusammen mit mir das Punk-Sein in Deutschland gerade erst entwickelten. So kam es mir vor. Das war mein Ding. “Don’t know what I want but I know how to get it”. Jeder konnte so sein wie er wollte. Keine Vorschriften, keine Vorurteile. Nur Hippie durfte man nicht sein. Klar, dass ich mich von Harald trennen musste. Zum Abschied klaute er mir die paar Wertgegenstände, die mein möbliertes Zimmer hergab. Schmerzlich vermisste ich nur die Spiegelreflexkamera. Ich hatte meine erste Großstadtlektion gelernt, seitdem war ich Heroin-Usern gegenüber misstrauisch. Eine neue Kamera sollte ich erst drei Jahre später wieder bekommen, als mein irischer Freund mir eine aus einem Fotogeschäft klaute.

Aber das alles war jetzt nicht wichtig. Genauso wenig wie mein Studium. Das Nachtleben hatte mich voll im Griff und es war absolut erfüllend. “The Talking Heads” und viele andere Bands spielten live im Punk House, wo die Bühne nur ein abgeteiltes Stück Tanzfläche war, Auge in Auge mit den Fans, manche Musiker blieben hinterher noch ein Weilchen da. Wildes Pogo tanzen, sich vor Begeisterung gegenseitig mit Bier überschütten und ab und zu am Flipper austoben, solche Sachen waren jetzt wichtig. Ich lernte dort Nina Hagen kennen und schüttelte Rio Reiser die Hand.
Wie lange gab es das Punk House? Ich weiss es nicht. [Wolfgang Müller in „Subkultur Westberlin 1979-1989“ erzählt davon: „Im Sommer 1977 eröffnet das Funkhouse am Kurfürstendamm. Westberlin – Funky Town? Ein kapitaler Flop. Das Lokal läuft schlecht. Der Inhaber erkennt die Zeichen der Zeit. Eine kleine Buchstabenauswechslung hat große Folgen: Aus dem Funkhouse wird das Punkhouse. Und dieses Punkhouse entwickelt sich nun zum ersten Treffpunkt einer gerade erst im Entstehen begriffenen Westberliner Punkszene.“ ] Wenn ich die Vielfalt der Erlebnisse und der Konzerte dort addiere, komme ich auf gefühlte zehn Jahre. Es war aber wohl nur etwas mehr als ein Jahr.

Das Silvester zum Jahr 1978 erlebte ich schon mit meiner ersten Band, “DinA4”, die Mädchenband ohne Auftritte, aber mit Proberaum, den uns Blixa Bargeld in einem Keller in der Sponholzstrasse, Friedenau, besorgt hatte. Wir hatten uns im Punk House an der Theke kennengelernt und zusammengetan, Birgit, Barbara, Gudrun und ich. Wir entschieden uns für unsere Instrumente nach Gutdünken und Laune, denn Können war kein Kriterium. Silvester feierten wir in Gudruns Schöneberger Wohnung mit vielen Freunden und einem genialen Buffet voller Speisen, die mit Lebensmittelfarbe ihren ursprünglichen Charakter verlieren sollten: grüne Buletten, blauer Vanillepudding, sowas alles. Dazu mein erster LSD-Trip, eher unspektakulär.
Für mich war und ist Silvester allein schon ein Trip und dieses Feuerwerk über dem Wartburgplatz war einfach großartig. Ein paar Hippies waren auch da (aus Flensburg und Köln oder so), sie waren Musiker und hatten uns damit Einiges voraus. Sie waren okay, obwohl wir uns als Punks gern von den Hippies abgrenzten. Sie verhalfen uns später, als “Din A Testbild”, immerhin zum ersten richtigen Auftritt: 13. August 1978, Mauergeburtstag. Süße sechzehn Jahre Mauer wurden mit einer Torte gefeiert, die die
Berliner Punkband “PVC” von der Bühne herunter verteilte. Lecker! Ich glaube, es war schon eine gewisse Dankbarkeit für diesen Schutzwall vorhanden, der uns das besondere, zulagengeförderte, wehrdienstbefreite, West-Berliner Punkleben ermöglichte.
Beim Mauerfestival 1978 lernten wir die Düsseldorfer/Solinger Szene kennen. Musiker übernachteten bei uns und diese neuen Verbindungen brachten schöne Transitreisen mit sich. Wir spielten und tanzten im Ratinger Hof und in Hamburg. Ich erinnere mich heute nicht gut an die Einzelheiten. Liebesdinge spielten eine Rolle, Drogen natürlich und das, was wir definitiv nicht Rock’n’Roll nannten.
Zu der Zeit war ich bereits länger beim Plattenladen Zensor quasi “angestellt” um die Buchhaltung zu machen. Das brachte es mit sich, dass ich in Berlin alle Konzerte, die mich irgendwie interessierten, umsonst besuchen konnte. Ich bin gerade dabei eine Liste zu erstellen und die Länge, die Menge haut mich selbst um. Da wundert es mich nicht mehr, dass ich bald mein Studium geschmisssen habe. Das Leben war doch zu schön. Ich wollte es mir nicht von obskuren Aufgaben verderben lassen, die keinen Spaß machten und deren Sinn ich nicht erkennen konnte. Inzwischen wohnte ich auch in der Wartburgstrasse (Schöneberg), Parterre. Die Küche war schwarz lackiert, das Schlafzimmer bonbonfarben und das Wohnzimmer grün und blau, wie ich es heute noch schön finde. Der Vermieter regte sich fürchterlich auf und schrieb Briefe an meine Eltern und meine Hochschule. Das amüsierte mich. Es gab ein Klo in der Wohnung! Zum Baden ins Stadtbad gehen war kein Problem. Ein Problem war der Kohleofen, der sich meinen Heizkünsten fast immer verweigerte. Als ich, zu Silvester 1978/79, vom Weihnachtsbesuch bei der Familie in Westdeutschland zurückkam, hatte ich Glatteis im Flur. Es war der legendäre Schneewinter, (in Schneewehen steckengebliebene Züge, ausgefallene Heizung, Fahrgäste, die miteinander die letzten Rotweinreserven teilten). Ich kroch mit dicken Wollpullovern unter die Bettdecke. Die Silvesterparty im Übungsraum konnte ich eh nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag erfuhr ich, wer alles in welche Ecke gekotzt hatte.
Der Zensor war ganz in der Nähe, Belziger Str. 23. Burkhardt freute sich, dass ich mich mit seiner elenden Zettelwirtschaft und den Anforderungen des Steuerberaters beschäftigen wollte. Ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und mochte es, zwischen den Schallplatten (hatte doch selbst schon eine ansehnliche Sammlung zu Hause in den Obstkisten) und ihren Liebhabern zu arbeiten. Die vorderen Ladenräume gehörten dem Blue Moon, einem Rockabilly-Klamottenladen.
– wird fortgesetzt –
*”Du bist verrückt
Mein Kind
Du musst nach Berlin!
Wo die Verrückten sind
Da gehörst du hin!
Du bist verrückt
Mein Kind
Du musst nach Plötzensee.
Wo die Verrückten sind
Am grünen Strand der Spree!”
Berliner Volkslied. Die Melodie ist ein Marsch aus der selten gespielten und ersten abendfüllenden Operette “Fatinitza” (1876) von Franz von Suppé. Der Marsch ist im Libretto nicht textiert, die Worte hat der Berliner Volksmund hinzugefügt.
Familienportrait Teil 13 – “Spaghetti um halb eins” / 1958-62
1958 war mein Vater Helmut mit seiner Dissertation: “Das sprachliche Bild – Die Metapher”, fertig. Er reichte sie an der Uni Wien ein, die er sich seltsamerweise als Alma Mater ausgesucht hatte. Vermutlich wollte er ein wenig unbeschwertes Studentenleben, fernab von Frau und Kindern, nachholen. Denn durch zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft war ihm diese Erfahrung versagt geblieben. Offiziell war der Doktorvater der Grund, der nun einmal in Wien lehrte und der die Verbindung von Philosophie, Publizistik und Theaterwissenschaft akzeptierte.
Da die Promotion sich noch 1 bis 2 Jahre hinziehen würde, suchte Papa einen Job, aber nichts allzu festes, denn später, mit dem Doktortitel würde er zu Höherem streben. Sein SPD-Parteibuch brachte ihm einen Termin bei Willy Brandt ein, dem populären Regierenden Bürgermeister der Stadt. Der bot ihm an, im “Büro Willy Brandt” mitzuarbeiten, einem losen Zusammenschluss von Künstlern und Kreativen, die Public Relations für Brandt entwickeln sollten. Das Büro residierte im Haus am Lützowplatz, dass von Sozialdemokraten, Metallgewerkschaftlern und Künstlern genutzt wurde. Jule Hammer, ein umtriebiger Kulturmanager und Galerist leitete das Haus inoffiziell, ab 1963 bis 91 dann auch offiziell.
Jule Hammer kannte ich auch von SPD-Weihnachtsfeiern im Kurt-Schuhmacher-Haus im Wedding. Mein Vater musste dabei den Weihnachtsmann spielen. Er tat es ungern, weil es ihm, seiner Meinung nach, als ernsthaftem Schauspieler eigentlich nicht zuzumuten gewesen wäre. Jule Hammer verteilte die Geschenke an uns Kinder der Genossen. Hier lernte ich Hammers kleinen Sohn Thomas kennen, den ich 30 Jahre später wiedertreffen sollte.
Im Souterrain des Hauses am Lützowplatz trat Wolfgang Neuss auf, der dem Büro Willy Brandt auch nahe stand, aber nicht offiziell angehörte. Brandt war sich klar, Neuss war eine unberechenbare Größe, die seinen Ambitionen irgendwann schaden könnte. Der “Mann mit der Pauke” machte allabendlich Kabarett mit scharfen Improvisationen, die gefürchtet waren. Mein Vater nahm mich einmal mit, am Nachmittag. Neuss kiffte noch nicht, aber er nahm Tabletten, um richtig scharf zu sein und vielleicht auch um die Trauer um Wolfgang Müller zu kompensieren. Sein Partner, beruflich und privat, Wolfgang Müller, kam 1960 während der Dreharbeiten zu Das Spukschloß im Spessart bei einem Flugzeugabsturz in der Schweiz ums Leben. Wolfgang Neuss wurde mit den Worten: „Jetzt brauchen wir Sie auch nicht mehr!“ von den Dreharbeiten zu diesem Film entlassen. Die einzige Partnerin, die er danach neben sich duldete, zeigte mir mein Vater. Eine Frauenbüste, genannt “die Gips-Uschi aus der Motzstraße”.
Jule Hammer gab mit Neuss die Satirezeitung “Neuss Deutschland” heraus. Später wurde Hammers Sohn Thomas Lebensgefährte von Neuss, in dessen Haschisch- und Spät-Phase. Nach Neuss’ Tod in den 90ern, als ich für den Offenen Kanal Berlin arbeitete, traf ich Thomas wieder, der bei uns Live-Sendungen über Neuss produzierte. Thomas erinnerte an den genialen Kabarettisten, leider versuchte er auch Neuss-Texte zu interpretieren. Dazu hatte er keinerlei Talent und so wurde es eine typische OK-Sendung.
Brandt war verschlossen, er wurde mit meinem Vater und anderen Mitarbeitern nicht warm. Willy, der sich volksnah gab, war in Wirklichkeit ein einsamer Wolf. Immer blieb er unnahbar, selbst wenn man gemeinsam trinkt, was zu dieser Zeit häufig passierte. Im Rathaus und in der Partei wurde der Bürgermeister auch “Wein-Brandt” genannt.
Andere Kollegen im Büro Willy Brandt waren Günter Grass und Horst Geldmacher, genannt “Flötchen, weil der Grafiker und Musiker immer sein Instrument bei sich hatte und oft spontane Konzerte gab.
Über Geldmacher kursierte die Anekdote, wenn diesen der Weltschmerz drücke, hielte er sich wochenlang im Bett auf, ohne es zu verlassen. Auf der linken Seite des Bettes solle eine Kochplatte gestanden haben, auf der Flötchen Spaghetti kochte und daneben standen mehrere Bierkästen, die treusorgende Freunde vorbeigebracht hatten. Auf der rechten Seite landeten die ausgetrunkenen Flaschen, wieder gefüllt mit Flötchens Stoffwechselprodukten.
Das Personal-Tableau des Büros wurde durch weitere Genossen und Kunsttreibende ergänzt. Häufig wurden aus Arbeitstagen längere Zechgelage. Meist fing man unten bei Neuss an und trank sich dann durch West-Berlin. Wenn die Meute hungrig wurde, rief mein Vater meine Mutter an und flötete seinerseits: “Liebes Kätchen, magst du uns nicht was kochen?” Oft ließ sich meine Mutter darauf ein, sie fand es schon schick, prominente, wenn auch oft unkonventionelle Gäste zu bewirten.
Das Kätchen
Die Eltern auf einem Ball (links)
Weihnachtsfeier 1960
Käte kochte dann Spaghetti mit Tomatensoße und um halb eins saßen die Genossen Grass, Hammer oder Geldmacher und ihre weniger bekannten Kollegen bei uns zuhaus auf dem Teppich (die Stühle reichten nicht) und aßen Nudeln.
Mein Vater blieb dem Büro Willy Brandt verbunden, versuchte sich aber immer wieder in unterschiedlichen Berufen. Als Dozent, Übersetzer, Schauspiellehrer und auch als Schauspieler. Am 21.9.1962 stand er in “Das Testament des Hundes” von Ariano Suassuna, der ersten Inszenierung der Schaubühne (damals noch am Halleschen Ufer), auf der Bühne. Ich habe ihn gesehen, ich war sieben, er kam mit Sporen an den Stiefeln, als reicher Mann lautstark auf die Szene. Ich fand ihn furchtbar peinlich, so ist das wohl in diesem Alter.
(Vater in “Das Begräbnis des Hundes” in der Schaubühne)
Die letzte Aufgabe für das Büro, war die Planung einer Gala zum 50sten Geburtstag von Brandt. Mein Vater verbreitete das Motto des Abends würde sein: “Willy Brandt, kein falscher Fuffziger mehr.” Der etwas grobe Scherz meines Erzeugers kam Brandt zu Ohren und der feuerte ihn.
Irgendwann kam auch der Kassierer nicht mehr, der die Parteibeiträge eintrieb. Ein alter Mann, der als Kommunist im KZ gewesen sein sollte. Wir Kinder hatten Angst vor ihm, er hatte etwas unheimliches. Dr. phil. Helmut Kluge war aus der SPD ausgetreten, richtig zugehörig hatte er sich ohnehin nie gefühlt.
Marcus Kluge
– wird fortgesetzt –
Alle bisher erschienen Familienportraits sind hier zu finden:
Über Horst “Flötchen” Geldmacher: http://www.wochenkurier.de/archiv/2010/07/28/floetchen-geldmacher/
Dieses wunderbare Buch von Horst Geldmacher hat mich als 6-jähriges Kind mit Spirituals, Gospel und Blues bekanntgemacht. Die Gestaltung war stilistisch einzigartig. (Die Übersetzung von Grass war das einzig Überflüssige im Buch) Ich habe es geliebt, gelesen und danach gesungen, bis es auseinander fiel. http://www.amazon.de/Susanna-Ein…/dp/B0000BIF60